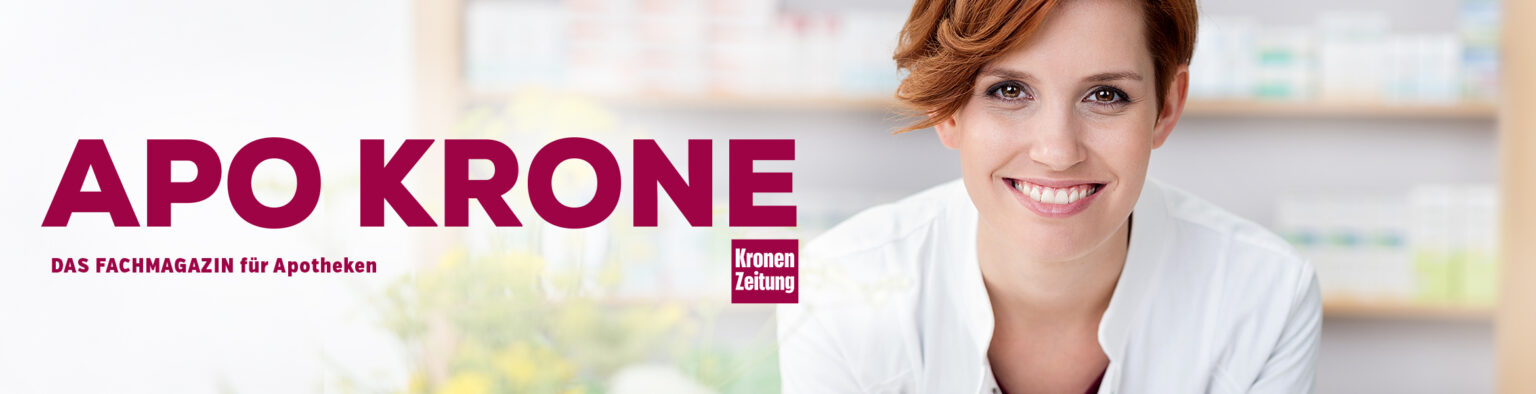Mietzins runter – aber wann?
Wird die Nutzung des Mietgegenstandes beeinträchtigt, sind Mieter:innen zur Zinsminderung berechtigt. Dies gilt aber nur, wenn die Mieter:innen selbst keine Schuld daran trifft. Minderungsgründe sind in der Praxis sehr verschieden: von Beeinträchtigungen durch Baustellen (z. B. Baulärm, Gerüste oder erhöhte Staubbelastung) über nichtfunktionierende Infrastruktur (Stromzuleitung, Heizung, Kühlung oder Wasser) bis hin zu optischen oder baulichen Beeinträchtigungen durch Feuchtigkeit, Wassereintritt oder Rissen. Auch für einen nichtfunktionstüchtigen Lift kann eine Minderung geltend gemacht werden. Die Judikatur des Obersten Gerichtshofes (OGH) erfasst zahlreiche Konstellationen.
Minderungsgrund Baustelle
Für die Beeinträchtigungen durch ein Baugerüst und Kran sowie eine stark eingeschränkte Sichtbarkeit des Mietobjektes wurde ein Minderungsanspruch von 50 % bestimmt. Mieter:innen, die von Baulärm betroffen waren, der u. a. zu Kopfschmerzen führte und teilweise Telefongespräche unmöglich machte, haben in der Vergangenheit zwischen 25 % und 75 % Minderung zugesprochen bekommen. Bei Baustellen kann vor allem auch die gesunkene Attraktivität des Mietobjektes zu einer Minderung führen (zum Beispiel wenn, um zur Apotheke zu kommen, erst eine große Baustelle durchquert werden müsste oder die Apotheke hinter einem Gerüst verschwindet). Mietzinsminderung kann auch dann verlangt werden, wenn Vermieter:innen die Beeinträchtigung nicht schuldhaft herbeigeführt haben. Vermieter:innen tragen das Risiko nämlich auch für alle auf Zufällen beruhenden Umstände. Die Mietzinsminderung ist kein Schadenersatz- sondern ein Gewährleistungsanspruch.
Maßstab ist der vereinbarte Vertragszweck. Eine „Apotheke mit Kundenverkehr“ ist bei der Frage der Nutzbarkeit anders zu behandeln als z. B. ein reines Lager. Versagt die Klimatisierung (falls das Versagen auf das Mietobjekt zurückzuführen ist) und ist die Kühlkette nicht mehr gesichert, kann der Mietzins für den betreffenden Monat vermutlich zur Gänze entfallen. Steht ein Lift länger still, obwohl Barrierefreiheit zugesagt ist, leidet der Zweckbetrieb erheblich. Hier kann eine Minderung ab etwa 20 % gerechtfertigt sein.
Bemessung
Es gibt keine festen Prozentsätze zur Bemessung der Minderungsquote. Die Rechtsprechung wendet eine relative Methode an: Man vergleicht den Mietzins für das mangelfreie Objekt mit dem, der für das konkret beeinträchtigte Objekt angemessen ist. Maßgeblich sind die Dauer und der Grad der Störung, die betroffenen Tageszeiten sowie Gesundheits- und Sicherheitsrisiken. Reine Umsatzrückgänge sind kein eigener Maßstab; sie zählen nur, soweit sie nachweisbare Folge der objektiven Gebrauchsminderung sind. Vermieter:innen haften nicht für das unternehmerische Risiko. In der Praxis reicht das Spektrum von kleinen Abschlägen bei leichten Störungen bis zur kompletten Befreiung bei vollständiger Unbenutzbarkeit des Objektes.
Nicht jede Beeinträchtigung löst eine Minderung aus. Wenn Mieter:innen den Mangel bei Einzug kannten oder kennen mussten (z.B. Anmietung eines Dachgeschosses ohne Sonnenschutz oder Kühlmöglichkeit) und den Vertrag dennoch vorbehaltlos abgeschlossen haben, nehmen sie die vorhandenen Mängel in Kauf. Speziell für Pachtverträge gilt: Ein vertraglicher Vorausverzicht auf die Geltendmachung der Zinsminderung ist möglich; bei Mietverträgen ist er unzulässig.
Vorgehen im Schadensfall
Wie geht man vor, wenn das Geschäftslokal ganz oder teilweise unbrauchbar ist? Zunächst ist es wichtig, die Beeinträchtigungen zeitnah zu dokumentieren – etwa durch Fotos, Temperatur- oder Lärmprotokolle (Dezibel-Messgeräte) und Dokumentation von Störungsmeldungen, Vorlage von behördlichen Bescheiden. Sodann ist die vermietende Person zu informieren und die beabsichtigte Vorgangsweise kurz zu begründen.
Die Minderung kann auf zwei Arten erfolgen: Entweder wird der volle Mietzins vorläufig unter ausdrücklichem Vorbehalt der Rückforderung bezahlt; dann lässt sich der zu viel bezahlte Betrag im Nachhinein zurückfordern. Oder die Miete wird monatlich in angemessener Höhe reduziert; das bringt Liquidität, birgt aber das Risiko, dass Vermieter:innen wegen teilweise unberechtigter Einbehaltung des Mietzinses auf Zahlung und Räumung des Mietgegenstandes klagen. Im Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) gibt es für Mieter:innen eine Absicherung: Trifft die Mieter:innen am Rückstand kein grobes Verschulden, kann bis zum Ende der mündlichen Verhandlung erster Instanz nachgezahlt werden, ohne dass der Mietgegenstand geräumt werden muss. Außerhalb des MRG, insbesondere bei Pachtverträgen, gibt es diese Möglichkeit nicht. Die Mietzinsminderung umfasst alle Bestandteile, also auch die Betriebskosten. Zeitlich ist die dreijährige Verjährungsfrist bei der Nachforderung der Mietzinsminderung zu beachten; sie beginnt ab Kenntnis des Minderungsanspruches.
Vielfach lassen sich Konflikte bereits bei Vertragsabschluss entschärfen. So empfiehlt es sich, bei Abschluss des Mietvertrages eine klare Vereinbarung über gewisse Eigenschaften des Mietgegenstandes aufzunehmen, z.B. „Betrieb einer öffentlichen Apotheke mit Kundenverkehr, Lagerung temperaturempfindlicher Arzneimittel, barrierefreier Zugang, Nachtapotheke“.
Es können auch Benachrichtigungspflichten sowie kurze Behebungsfristen für die Vermieter:innen vereinbart werden. Ist die Apotheke in einem Einkaufszentrum, sind Mindestöffnungszeiten beziehungsweise Zugangssicherung (Parkplätze, Aufzüge, Rolltreppen, Türen) mitzudenken. Bei Einkaufszentren ist auch zu beachten, dass hier das MRG nicht zur Anwendung kommt. Eine Mietzinsminderung muss hier wohlüberlegt sein.
Beim Thema Mietzinsminderung ist aus Mietersicht eine gut überlegte Vorgehensweise unumgänglich, weil bei überhöhter Minderung in bestimmten Fällen die Vermieter:innen den Mietvertrag vorzeitig auflösen können, selbst wenn er unbefristet abgeschlossen wurde.