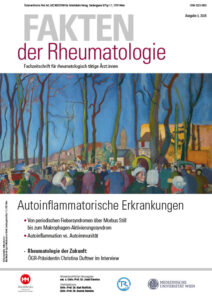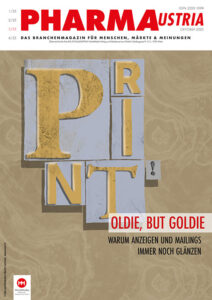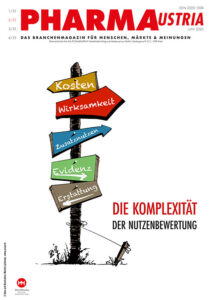Nachhaltige Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems
“Die nachhaltige Finanzierung des solidarischen Gesundheitswesens ist nur möglich, wenn wir mit den Ressourcen – finanzieller sowie personeller Natur – achtsam umgehen“, betont Dr. Wolfgang Tüchler, Geschäftsführer von Axxess Healthcare Consulting. Er ist überzeugt, dass es dafür mehr Mut braucht: „Wir müssen uns trauen, Innovationen zu belohnen sowie Ineffizienzen und Überversorgung abzuschaffen.“
Dies sieht Dr.in Ingrid Zechmeister-Koss, MA, Geschäftsführerin des AIHTA, ähnlich: Eine große Herausforderung bezüglich der Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems besteht für sie darin, dass zwar laufend neue Leistungen ins System eingebaut werden, es aber keine Strategie für De-Implementierungen gibt. „Wir brauchen ein Verfahren, wie wir überholte Therapien aus dem System herausnehmen können. Dieses sollte gemeinsam mit Ärzt:innen und anderen Gesundheitsberufen erarbeitet werden. Denn rund 20% der Gesundheitsausgaben sind laut OECD unnötig – aber Gewohnheiten sind leider nur schwer zu ändern …“, so die Expertin.
Finanzierungsströme überdenken
Zechmeister-Koss und Tüchler sind sich zudem einig, dass die fragmentierte Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems ein großes Problem darstellt. „Wir denken nicht in einem Gesamtsystem, dabei wäre dies sehr wichtig“, sagt Zechmeister-Koss. Auch für Tüchler führt die duale Finanzierung des österreichischen Gesundheitswesens zu Ineffizienz. Er spricht sich daher ebenfalls für eine Harmonisierung der Finanzierungsströme aus.
Dr. Ronald Pichler, Head of Public Affairs & Market Access bei der PHARMIG, sieht hinsichtlich der nachhaltigen Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems zwei Dynamiken: den medizinischen Fortschritt mit immer neuen innovativen Therapien und die demografische Entwicklung. „Die Menschen werden immer älter, der Bedarf an Arzneimitteln steigt im höheren Lebensalter und gleichzeitig geht die Beitragszahlerbasis zurück, u.a. aufgrund vieler Teilzeit-Erwerbstätiger, geburtenschwacher Jahrgänge etc. Daher müssen wir jetzt die Weichen stellen für die Zukunft und die Finanzierungsströme des Gesundheitssystems neu ausrichten“, ist Pichler überzeugt. Seiner Ansicht nach reichen die Arbeitnehmer:innen- und Arbeitgeber:innen-Beiträge in der bisherigen Form für die Sozialversicherung nicht mehr für eine nachhaltige Finanzierung aus: „Wir müssen auch damit rechnen, dass in einigen Jahren die künstliche Intelligenz eine Reihe von Jobs übernehmen wird – und die KI zahlt keine Sozialversicherungsbeiträge.“ Pichler plädiert daher dafür, über neue Beitragsformen nachzudenken, die ihren Ursprung nicht ausschließlich in der Erwerbstätigkeit haben.
Ausbau von Datennutzung
Priv.-Doz. Dr. Robert Sauermann, Abteilungsleiter Vertragspartner Medikamente beim Dachverband der Sozialversicherungsträger, hält es für unerlässlich, darauf hinzuwirken, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis angemessen ist. „Zudem brauchen wir – bei strikter Beachtung des Datenschutzes – eine bessere Nutzung von Gesundheitsdaten, um daraus wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, wie wir sowohl neue als auch bereits eingeführte Therapien optimal einsetzen, um den bestmöglichen Nutzen für die Patient:innen zu erzielen.“ Er ist zudem davon überzeugt, dass es gilt, laufend Bereiche mit Einsparungspotenzial zu eruieren, damit sich das Gesundheitssystem wichtige Innovationen weiterhin leisten kann. „Wir müssen eine gute Balance zwischen Investitionen in relevante Innovationen und Einsparungen bei gleichbleibender Versorgungsqualität finden. Dann können wir ein leistungsstarkes Gesundheitssystem erhalten“, so Sauermann abschließend.
Prävention und Gesundheitskompetenz stärken
„Weiters müssen wir uns auf eine Steigerung der gesunden Lebensjahre konzentrieren. Was diese angeht, liegt Österreich nur im Mittelfeld, hier wäre viel möglich durch Bildung, gesundheitsförderliche Maßnahmen, Stärkung des sozialen Zusammenhalts etc.“, fügt Zechmeister-Koss hinzu. Sie plädiert für ein System, das sich nicht nur auf Reparaturmedizin fokussiert, sondern auch der Prävention mehr Raum – und Geld – zur Verfügung stellt. Dem stimmt auch Tüchler zu: „95% der Gesundheitsausgaben fließen in die Reparaturmedizin, nur 5% in die Prävention. Wir müssen mehr Geld in den Bereich ‚gesund bleiben‘ investieren und zudem die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken. Dazu gehört, dass die Menschen Gesundheitsinformationen verstehen und umsetzen können. Auch das würde das System hinsichtlich finanziell und personell benötigter Mittel entlasten.“