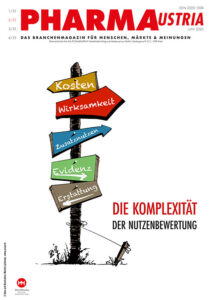Mikrovaskuläre KHK: Die weibliche Seite der Herzkrankheit
Entgeltliche Einschaltung
Der Herztod ist weiblich. Während in Österreich knapp über 36 % der Männer an kardialen Ursachen versterben, sind es bei den Frauen – entgegen allen Klischees – mehr als 45 %. Ein besonderes Krankheitsbild, das Frauen deutlich häufiger betrifft als Männer, ist die mikrovaskuläre koronare Herzkrankheit und der Myokardinfarkt mit nichtobstruktiven Koronararterien (MINOCA).
„Die Statistik zeigt, dass fast jede zweite Frau in Österreich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung stirbt“, resümiert ao. Univ.-Prof. Dr. Jeanette Strametz-Juranek, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie an der Medizinischen Universität Wien und leitende Ärztin im Rehabilitationszentrum Bad Tatzmannsdorf der PVA, im Rahmen eines Vortrags beim Woman’s Health Summit. Bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeigt sich sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein deutliches Risikogefälle, bei dem der Osten substanziell schlechter abschneidet. Koronare Herzkrankheit reduziert generell die Lebensqualität– wovon Frauen in höherem Maßbetroffen sind als Männer. Die Zusammenhänge des weiblichen Risikos mit der hormonellen Situation sind bekannt. Die Menopause ist aus kardiovaskulärer Perspektive mit einer Reihe ungünstiger Veränderungen verbunden. So kommt es zu einem Ansteigen der Androgenspiegel, einem Anstieg der Insulinresistenz und einer Gewichtszunahme. Faktoren wie eine gesteigerte Salzsensitivität oder Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems begünstigen eine endotheliale Funktionsstörung, Inflammation und Atherosklerose. Die sympathische Aktivierung führt zu abnehmender Stressresistenz. Dies ist besonders problematisch bei Frauen, die verfrüht, in ungünstigen Fällen vor dem 40. Lebensjahr, in die Menopause kommen. Aus vielen dieser genannten Faktoren lassen sich Lebensstil-Empfehlungen ableiten. Beispielsweise rät Strametz-Juranek Frauen in der Menopause, mit dem Salzkonsum vorsichtig zu sein. Ein speziell für Frauen relevantes Thema ist die mikrovaskuläre koronare Herzkrankheit. Studien zeigen bei Frauen mit akutem Koronarsyndrom im Vergleich zu Männern eine deutlich höhere Prävalenz von nicht obstruktiver Erkrankung.1 Die mikrovaskuläre KHK zeigt im intravasalen Ultraschall eine deutliche exzentrische Verdickung des Endothels – und unterscheidet sich damit von der bei Männern vorherrschenden konzentrischen Verdickung des Endothels. Dies mag einer der Gründe sein, warum bei mikrovaskulärer KHK die Angiografie häufig völlig unauffällig bleibt. Während Männer ausgeprägte Stenosen mit messbarem Druckabfall entwickeln, zeigen Frauen multiple, kleine Veränderungen der Koronarien, die den Flussgradienten kaum messbar beeinflussen. Die mikrovaskuläre KHK wird mittlerweile in den Leitlinien der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft als eigenständiges Krankheitsbild berücksichtigt.
Hormonelle Abhängigkeit der mikrovaskulären KHK
Angesichts der hohen Bedeutung der mikrovaskulären Strukturen für die Versorgung des Myokards ist es naheliegend, dass es bei mikrovaskulärer KHK zu massiven Beschwerden und Funktionseinschränkungen führen kann.2 Verantwortlich für die Entwicklung einer mikrovaskulären KHK sind die bekannten kardiovaskulären Risikofaktoren. Darüber hinaus haben aber auch Sexualhormone einen wichtigen Einfluss. Strametz-Juranek: „Bei Frauen vor der Menopause ist die mikrovaskuläre KHK selten. Kommt es jedoch zu einer Reduktion der Östrogenversorgung durch die Menopause, iatrogen oder zum Beispiel durch ein polyzystisches Ovarialsyndrom, so steigt das Risiko einer mikrovaskulären Herzerkrankung.“ Diese hat sich in Studien als prognostisch ungünstig erwiesen und erhöht das Risiko, an einem akuten koronaren Geschehen zu versterben.3 Eine Studie aus dem Jahr 2009 fand bei rund der Hälfte der Frauen mit nichtobstruktiver KHK eine mikrovaskuläre Dysfunktion, die ihrerseits mit Myokardinfarkt, kardiovaskulärem Tod und Herzinsuffizienz innerhalb von fünf Jahren assoziiert war.4 Die Leitlinien empfehlen, Risikofaktoren in den Zielbereich zu bringen; dies betrifft den Blutdruck ebenso wie die Lipide und das metabolische Syndrom. Die Ischämie kann mit Beta-Blockern, Kalzium-Blockern, Ivabradin oder Ranolazin beeinflusst werden.
1 Merz NB et al., Am J Manag Care 2001 (Oct.); 7(10):959–65
2 Herrmann J, Kaski JC, Lerman A, Eur Heart J 2012 (Nov.);33(22):
2771–82b
3 von Mering GO et al. Circulation 2004 (Feb 17); 109(6):722–5
4 Gulati M et al., Arch Intern Med 2009 (May 11); 169(9):843–50
Quelle:
Webkongress Woman’s Health Summit, 2.–3. Oktober 2020, Vortrag:
Prim. Univ.-Prof. Dr. Jeanette Strametz-Juranek: „Sind Frauen anders
krank? Gendermedizin am Beispiel der Kardiologie“
Entgeltliche Einschaltung