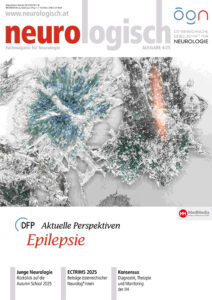Evidenzbasierte Medizin: Mehr als wissenschaftliche Analyse
Prof. Gerald Gartlehner: Evidenzbasierte Medizin bedeutet im Wesentlichen, dass Ärztinnen und Ärzte bei klinischen Entscheidungen das beste verfügbare wissenschaftliche Wissen miteinbeziehen sollen.
Eine gute medizinische Entscheidung besteht aus drei Säulen: der klinischen Erfahrung des Behandlers, den Patientenpräferenzen und -werten und der aktuellen Evidenz aus wissenschaftlichen Studien. Viele, die sich mehr mit diesem Thema beschäftigen, sagen, dass der Begriff „evidenzbasierte Medizin“ eigentlich überholt ist – es sollte vielmehr „evidenzinformierte Medizin“ heißen, damit klarer herauskommt, dass die Wissenschaft nur ein Teil des Ganzen ist.
Dass dem leider nicht immer so ist, zeigt sich vor allem an den regionalen Unterschieden. Um nur ein Beispiel zu nennen: In Deutschland gibt es zwischen den Bundesländern einen enormen Unterschied bei den Tonsillektomien. In manchen Regionen wird achtmal häufiger operiert als in anderen. Beides gleichzeitig kann nicht richtig sein – entweder die einen bekommen zu wenig Behandlung oder die anderen erhalten eine Therapie, die sie eigentlich nicht benötigen würden, was genauso problematisch ist. In Österreich ist das wahrscheinlich ähnlich, nur dass hier für solche Vergleiche kaum gute Daten vorliegen.
Die Leitlinien der Fachgesellschaften sind ein wichtiges Instrument der evidenzbasierten Medizin geworden. Leider sind nicht alle gleich gut gemacht. Hier fließen häufig noch andere – oft standespolitisch motivierte – Interessen ein. Darüber hinaus bestehen häufig Interessenkonflikte durch die finanziellen Zuwendungen aus der Industrie. Daher lohnt es sich, genauer hinzusehen, wie die Leitlinien erstellt wurden. Von der Medizinischen Universität Graz wurde ein Instrument entwickelt, mit dem sich durch fünf bis sechs Fragen einschätzen lässt, wie verlässlich eine Leitlinie im Hinblick auf Interessenkonflikte ist. Das sind Fragen wie: Wurde offengelegt, wer die Leitlinie finanziert? Wurde die Leitlinie aufgrund von systematischer wissenschaftlicher Evidenz erstellt? – Dieses praxistaugliche und validierte Instrument kann jeder Arzt ganz einfach anwenden.
Es ist schon richtig, dass Leitlinien anhand von wissenschaftlichen Studien erstellt werden. Man muss jedoch auch die Frage nach der Methodik der Erstellung stellen. Werden diese Studien auf Basis von systematischen Reviews identifiziert oder bringt bei der Erstellung der Leitlinie jeder Experte im Panel die Studien vor, die er kennt? Wenn man nicht systematisch an die wissenschaftliche Literatur herangeht, dann ist die Chance relativ groß, dass einem vorrangig jene Studien einfallen, die am meisten Marketing durch die Industrie erhalten haben – und das sind dann zumeist jene, welche die größten Effekte einer Therapie zeigen.
Das ist sicher das spannendste Projekt, an dem wir derzeit arbeiten. Die WHO ist an uns herangetreten und hat uns gebeten, sie bei Entscheidungen und Empfehlungen hinsichtlich des Coronavirus mit Evidenz zu unterstützen. Wir sind ein sogenanntes WHO-Collaborating Centre und arbeiten daher mit der WHO immer wieder zusammen. Die besondere Herausforderung ist jetzt, dass wir gebeten wurden, innerhalb weniger Tage Antworten auf konkrete Fragestellungen zu liefern für ein Projekt, das normalerweise ein halbes Jahr dauert. So zum Beispiel: Wie wirksam ist Quarantäne beim SARS-CoV-2? Soll Quarantäne mit antiviraler Therapie kombiniert werden? – Natürlich gibt es noch sehr wenig Evidenz zum SARS-CoV-2, daher müssen wir von anderen ähnlichen Epidemien, wie beispielsweise SARS oder MERS, Evidenz finden, um von diesen abzuleiten oder passende Modellierungsstudien durchführen.
„Gemeinsam gut entscheiden“ ist ein Projekt nach dem Vorbild der US-amerikanischen Initiative „Choosing Wisely“, bei dem in Zusammenarbeit mit österreichischen Fachgesellschaften die Top-5-Empfehlungen dazu erstellt werden, was man nicht tun soll. Zwei der fünf wichtigsten Empfehlungen aus der Geriatrie sind beispielsweise, dass asymptomatische Bakteriurien bei älteren Personen nicht antibiotisch behandelt werden müssen und dass bei Patienten mit begrenzter Lebenserwartung gut überlegt werden sollte, ob Früherkennungsuntersuchungen auf Krebs Vorteile bringen. Im Endeffekt geht es bei diesem Projekt darum, Überbehandlungen oder unnötige Folgeuntersuchungen und Verunsicherung zu vermeiden. Bisher haben wir diese Top-5-Listen gemeinsam mit und für die Fachgesellschaften für Geriatrie und Allgemeinmedizin erstellt.
Über das Ärzteinfozentrum ebminfo.at können Ärzte medizinische Anfragen direkt an uns stellen, die dann von unseren Mitarbeitern innerhalb von vier Wochen beantwortet werden. Die zur Frage vorhandene Evidenz wird recherchiert, methodisch evaluiert und in einem übersichtlichen, kurzen Dokument lesbar zusammengetragen. Darin beurteilen wir dann auch unser Vertrauen in diese Ergebnisse – ähnlich wie in einem systematischen Review, nur ohne die aufwendige duale Bewertung.
Jenen, dass ein Team von Wissenschaftern sich wirklich Ihrer spezifischen Frage widmet. In den meisten Fällen haben die Mediziner, die ihre Anfrage schicken, bereits versucht, diese über andere Quellen zu beantworten, sind aber nicht fündig geworden. Derzeit kann der Service nur von Spitalsärzten aus Niederösterreich genutzt werden, die NÖ Landeskliniken Holding finanziert jährlich 25 Anfragen. Wir erhalten allerdings wesentlich mehr Anfragen, als wir mit diesen Ressourcen durchführen können. Bisher haben wir 300 bis 400 Anfragen bearbeitet, die Ergebnisse sind online öffentlich und kostenfrei einsehbar.
Ein ähnliches Projekt, das sich jedoch an die Allgemeinbevölkerung richtet, ist „Medizin Transparent“. Auch hier beantworten wir evidenzbasiert Anfragen zu Themen, für die es keine klassische Patienteninformation gibt, die die Leute aber interessieren. Oft geht es um Fragen zur Wirksamkeit bestimmter Therapien. Das kommt sehr gut an, hat uns mittlerweile aber auch zwei Klagen durch die Industrie eingebracht.
In beiden Fällen fiel unsere Bewertung negativ aus, da die aufgestellten Gesundheitsbehauptungen nicht durch Studien zu belegen waren. Die Aussagen basierten auf reinen Bioverfügbarkeitsstudien, und man hat medizinische Schlussfolgerungen aufgestellt, die nie bewiesen wurden. Es passiert immer wieder, dass solche Ergebnisse in eine Richtung ausgedehnt werden, die nicht mehr wissenschaftlich belastbar ist.
Es ist tatsächlich so, dass in vielen Fällen keine Evidenz vorliegt. Dann ist die korrekte methodische Art, zu sagen: Wir wissen es nicht. Es gibt weder Evidenz dafür noch dagegen. In unserer Bewertung geben wir dann auch an, dass wissenschaftliche Belege zur seriösen Beantwortung der Anfrage fehlen oder sich die Behauptung nicht belegen lässt.
Wenn die Säule der Evidenz nicht vorhanden ist, dann bleiben die anderen beiden – klinische Erfahrung und Patientenwerte – über. Solange das Schadenspotenzial gering oder nicht vorhanden ist, aber die Erfahrung des Arztes dafürspricht, gibt es keinen Grund, davon abzuraten. Was in der Medizin nicht zu unterschätzen ist, sind sowohl die Placebowirkung als auch die psychologische Komponente über das Arzt-Patienten-Verhältnis, dessen Wirkung auf den therapeutischen Outcome enorm groß ist. Und diese Effekte kann man natürlich nutzen. So stehen wir beispielsweise der Homöopathie sehr kritisch gegenüber, wahrscheinlich ist es aber immer noch besser, jemandem bei einem banalen Infekt ein homöopathisches Mittel zu geben, als ein Antibiotikum zu verschreiben. Wenn die Patienten das annehmen und damit zufrieden sind und den Ärzten bewusst ist, dass die Wirkung wahrscheinlich nicht über die eines Placebos hinausgeht, ist durchaus ein pragmatisches Vorgehen angebracht.
Medizinmythen spielen eine immer größere Rolle und können zu massiven Schäden führen, wenn Sie beispielsweise an das Thema Impfen denken. Das Schwierige ist, diese Mythen zu entkräften, da sie eine gewisse Eigendynamik entwickeln, der man fast nicht nachkommt. Was wir uns wünschen würden, ist, dass es in Österreich etwas Ähnliches gibt wie das Norwegean Knowledge Center. Der Staat Norwegen nimmt jährlich etwa 30–40 Millionen Euro in die Hand, um objektive, verlässliche Gesundheitsinformation in der Landessprache für die Bevölkerung zu erstellen. In Österreich wird dies gerne der Industrie überlassen. Ich möchte den sponsernden Pharmafirmen zwar nicht unterstellen, dass sie überall Einfluss auf den Inhalt nehmen, bin aber der Meinung, dass Österreich so etwas nicht nötig haben sollte. Öffentliche Stellen und staatsnahe Betriebe haben 2018 rund 170 Millionen Euro für Werbung und Inserate ausgegeben – in erster Linie für Eigenwerbung der Politik. Nur ein sehr kleiner Bruchteil davon wird für objektive medizinische Information verwendet, hier ist also großes Potenzial vorhanden.
Wir beobachten, dass insbesondere die jüngeren Kollegen bereits auf dem richtigen Weg sind. Für sie ist es völlig normal, Studien zu lesen, zu recherchieren und das erworbene Wissen in ihre Entscheidungen einzubeziehen. Allen, die noch Berührungsängste mit EBM haben, kann ich nur empfehlen, die vorhandenen Tools wie UpToDate, DynaMed oder auch die EBM-Guidelines für Allgemeinmedizin einmal auszuprobieren. Das sind wirklich gut gemachte Ressourcen, auf die man zugreifen kann und die sich auch im klinischen Alltag in einer kurzen Pause zwischen zwei Patienten einsetzen lassen. Viele machen den Fehler, gleich auf PubMed zu gehen, wo sie mit mehreren Tausend Studien und Reviews mit Information überflutet werden. Jährlich werden zwei bis drei Millionen neue medizinische wissenschaftliche Artikel publiziert. Ohne gut gemachte Wissensmanagement-Tools ist es selbst in einem engen Fachgebiet praktisch unmöglich, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.