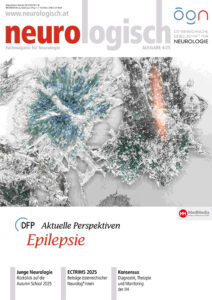Bundesländer diskutieren ME/CFS-Versorgung
 © kite_rin - stock.adobe.com
© kite_rin - stock.adobe.com Menschen mit postakuten Infektionssyndromen wie Post Covid oder ME/CFS sind laut jüngster Kritik unterversorgt. Jetzt wird der Nationale Aktionsplan noch einmal überarbeitet. Ein Referenzzentrum der MedUni Wien bietet aktuelle Informationen.
Die Diskussion um Betreuungszentren für Patient:innen mit postakuten Infektionssyndromen (PAIS) wie Post Covid oder ME/CFS hat in den vergangenen Monaten auch die Frage nach Diagnose- und Therapieoptionen in den Mittelpunkt gerückt. Die Diagnose- und Therapieoptionen sowie Versorgungsangebote sind noch ausbaufähig. Bund und Länder diskutieren am Freitag bei der Landesgesundheitsreferent:innentagung in Salzburg erneut die Einrichtung von spezialisierten Stellen. Und es dürfte auch weiter dauern. Der Nationale Aktionsplan (NAP) des Bundes wird nun noch einmal überarbeitet.
„Im Plan stehen viele richtige Dinge, aber er ist noch nicht mit allen Beteiligten im letzten Stadium besprochen worden“, sagte die für Gesundheit zuständige Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). In einem ersten Schritt sollen bis Ende des Jahres alle Angebote für Betroffene in Österreich überprüft werden. Danach soll mit der Einrichtung von Anlaufstellen begonnen werden. Ob es dabei in jedem Bundesland Behandlungszentren geben werde, könne man noch nicht sagen, betonte Königsberger-Ludwig. Die Grünen kritisieren das scharf und orten einen „Kniefall vor unwilligen Ländern und der PVA.“ Die Versorgung verzögere sich damit weiter.
Das an der MedUni Wien angesiedelte Referenzzentrum für postvirale Syndrome bietet indes auf seiner interimistischen Webseite umfassendes Informationsmaterial für Gesundheitsdienstleister. Neben Leitfäden für die Diagnose und Behandlung findet sich auch eine neue Zahlengrundlage für spezialisierte ME/CFS-Behandlungsstellen in der „extramuralen“ Fachversorgung (z.B. Spezialambulanzen, Ambulatorien oder Fachzentren) in den Bundesländern. Ebenso haben die Leiterinnen des Referenzzentrums über ihre Tätigkeiten an der Medizinischen Universität Wien auch eine Empfehlung zu Struktur und Prozess dieser spezialisierten Behandlungsstellen herausgegeben.
Grundsätzlich gibt es für die Diagnose von Post Covid oder ME/CFS nicht den „einen“ Biomarker, etwa einen Bluttest. Allerdings sind zahlreiche Untersuchungen möglich, die die Diagnose untermauern bzw. Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) beweisen, was wiederum zu therapeutischen Konsequenzen führen kann. Für ME/CFS sollten darüber hinaus laut den Leitfäden die sogenannten kanadischen klinischen Diagnosekriterien verwendet werden.
Bei postviralen Symptomen (wie Post Covid oder auch ME/CFS) kommt es oftmals zu Schwierigkeiten mit der Kreislaufregulation in aufrechter Position (Orthostase-Probleme) wie POTS (übermäßiger Pulsanstieg) oder orthostatische Hypotonie (übermäßigen Blutdruckabfall). Dabei können auch Symptome wie Ohnmachtsgefühle, Schwindel, Schmerzen in den Beinen, Verfärbungen der Extremitäten, kognitive Störungen oder Bauchschmerzen auftreten. Grund ist eine Störung des autonomen Nervensystems, die eine Fehlregulierung der Blutgefäße zur Folge hat. Diese Störungen sind durch einen einfachen, aber etwas zeitaufwendigen Test leicht nachzuweisen (Schellong-Test). Noch detaillierter diagnostizieren lässt sich dies mittels eines Kipptischtests an spezialisierten Einrichtungen bzw. Krankenhäusern. Auch durch das autonome Nervensystem bedingte Magen-Darm-Probleme können durch Untersuchungen dargestellt werden.
Oftmals vorkommende Durchblutungsprobleme in den kleinen Kapillaren sind u.a. durch spezialisierte Blutuntersuchungen oder mittels Kapillarmikroskopie nachweisbar, wie auch neueste Studien belegen. Ebenso im Labor bestimmt werden können Marker, die endokrinologische Störungen, Immundefizite oder Auto-Immunreaktionen untermauern, die allesamt bei postakuten Infektionssyndromen oft vorliegen. Auch das oftmals begleitende Mastzellaktivierungssyndrom lässt sich durch Anamnese, spezialisiertes Blutlabor oder Gewebeprobe der Magen- oder Darmschleimhaut nachweisen. Im Labor bestimmbar ist darüber hinaus beispielsweise die Reaktivierung von „schlummernden“ Viren wie dem Epstein-Barr-Virus (EBV).
Das Kardinalsymptom von ME/CFS – die Post-Exertional Malaise (PEM) – kann diagnostiziert werden, sofern der Zustand von Patient:innen eine derartige Belastung zulässt. Wichtig ist festzustellen, dass PEM nach einer (auch nur leichten) belastenden Tätigkeit auftritt, oft mit ein bis zwei Tagen Verzögerung beginnt und die Zustandsverschlechterung mindestens 14 Stunden anhält. Antrieb und Motivation sind dabei nicht beeinträchtigt. Zusätzlich möglich ist etwa die Messung der muskulären Erschöpfung der Handmuskulatur (Handkraftmessung) im Abstand von rund einer Stunde oder ein zwei Mal durchgeführter einminütiger „Sit-to-Stand“-Test im Abstand von einer Stunde. Wichtig ist, dass immer zweimal gemessen wird, da PEM erst nach der Aktivität auftritt.
Bei den Therapieoptionen gibt es derzeit keinen „heilenden“ Ansatz, allerdings kann symptomatisch viel für die Patient:innen getan werden. POTS ist beispielsweise mit einer Kombination aus medikamentöser und auch konservativer Therapie behandelbar. Beim Vorliegen von Mikrozirkulationsstörungen oder einer Schädigung des Endothels können im Off Label-Einsatz etwa Blutverdünner oder auch Statine zur Anwendung kommen. Das Mastzellaktivierungssyndrom kann ebenso medikamentös behandelt werden, das gilt auch für Schlafstörungen und Schmerzen. Auch bei (wahrscheinlich durch Neuroinflammation ausgelösten) kognitiven Dysfunktionen gibt es medikamentöse Therapieansätze. Relevant ist auch das Einhalten der individuellen Belastungsgrenzen (Pacing) beim Vorliegen von PEM, was zwar keine therapeutische Option im Sinn einer Verbesserung ist, aber Verschlechterung verhindert.
Neben einer Stabilisierung der Patient:innen kann mit diesen symptomlindernden Behandlungen in vielen Fällen auch eine Verschlechterung der Erkrankungen verhindert werden, wie die Leiterinnen des Referenzzentrums anlässlich der Vorlage einer Off-Label-Medikamentenliste im Februar dieses Jahres betonten. Die Leiterinnen Untersmayr-Elsenhuber und Kathryn Hoffmann verwiesen darauf, dass die Medikamente von (Haus-)Ärzt:innen verschrieben werden können, die Krankenkassen tragen die Kosten. (APA/red)