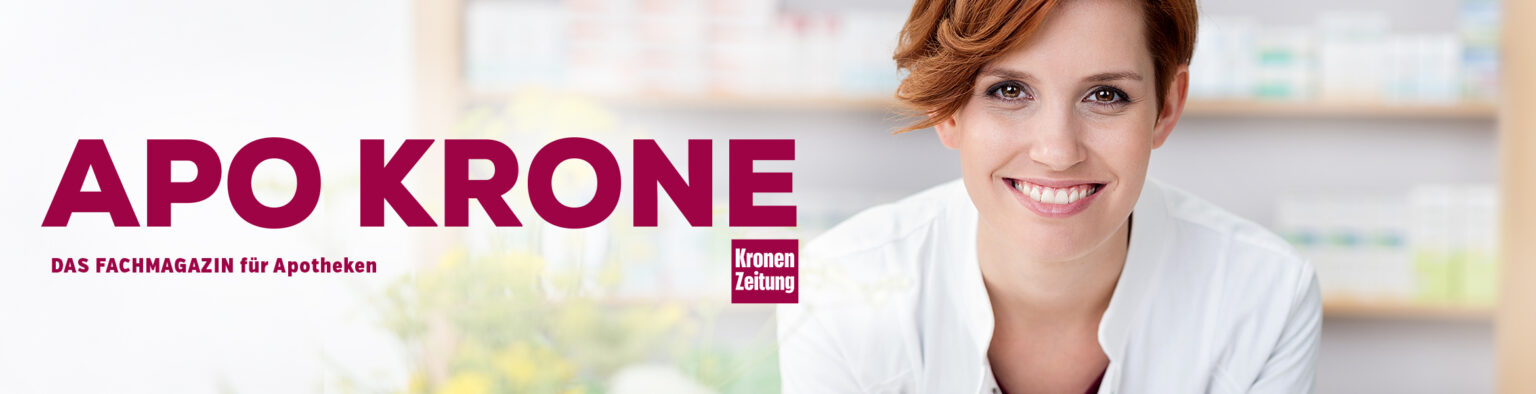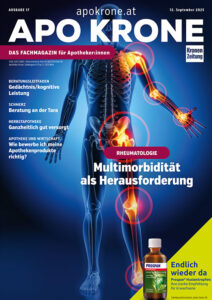Die Nachfrage nach Mikronährstoffpräparaten steigt in der kalten Jahreszeit oft an. Viele Patient:innen suchen Unterstützung, um gut durch Herbst und Winter zu kommen, Infekte zu vermeiden und das Wohlbefinden zu stärken. Neben dem Wunsch nach einer optimalen Immunfunktion spielen auch Energiehaushalt und psychische Belastbarkeit eine wichtige Rolle. Nicht selten informieren sich Ratsuchende bereits im Vorfeld im Internet. Doch zwischen fundierten Daten und unbelegten Behauptungen zu unterscheiden fällt vielen schwer. Hier kommt der Beratung in der Apotheke eine Schlüsselrolle zu: Sie ermöglicht es, evidenzbasierte Empfehlungen auszusprechen, unnötige oder falsch dosierte Supplementierungen zu vermeiden und Patient:innen individuell zu unterstützen.
Mikronährstoffe
Damit die Immunabwehr in allen Lebensbereichen möglichst reibungslos ablaufen kann, ist der Körper auf die ausreichende Versorgung mit ausgewählten Mikronährstoffen angewiesen. Essenziell sind unter anderem die Vitamine A, C, D, E, B2, B6 und B12 sowie Folsäure, Eisen, Kupfer, Selen und Zink. Sie wirken synergistisch und sind an nahezu allen Prozessen der Immunabwehr beteiligt.1,2 Ein besonderes Augenmerk gilt den Mikronährstoffen Jod, Eisen, Vitamin A und Zink, da deren Mangel zu den weltweit bedeutendsten Gesundheitsrisikofaktoren zählt.3, 4 Sowohl im ärztlichen Gespräch als auch in der pharmazeutischen Beratung lassen sich potenzielle Nährstoffdefizite durch gezieltes Nachfragen nach typischen Symptomen frühzeitig erkennen und anschließend mit einer angepassten Ernährung oder einer geeigneten Supplementierung ausgleichen. Dabei sollte Patient:innen stets vermittelt werden, dass Mikronährstoffpräparate keine ausgewogene Ernährung ersetzen, sondern vorhandene Defizite gezielt kompensieren können. Eine fundierte Beratung umfasst zudem Hinweise auf mögliche Wechselwirkungen sowie Empfehlungen zur richtigen Einnahmeform, etwa die Kombination lipophiler Vitamine mit einer fetthaltigen Mahlzeit.
Vitamin A
Da Vitamin-A-(Retinol-)Mangel in einkommensstarken Ländern nur selten auftritt, wird er häufig übersehen. Weltweit zählt er jedoch nach wie vor zu den Hauptursachen für Erblindung im Kindesalter. Um Morbidität und Mortalität zu senken, sollte die Diagnose bei Risikopatient:innen mit entsprechenden Symptomen laut Song et al. stets in Betracht gezogen werden.5 Das fettlösliche Vitamin ist nicht nur für die Sehkraft, sondern auch für die Immunfunktion, die Zelldifferenzierung und die Embryonalentwicklung von zentraler Bedeutung. Während Retinol ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt, liefern pflanzliche Quellen wie Paprika oder Kürbis Provitamin-A-Carotinoide, die im Körper in Retinol umgewandelt werden können. Besonders in der Schwangerschaft ist bei der Einnahme von Vitamin A Vorsicht geboten. Zwar steigt der Bedarf, eine übermäßige Aufnahme sollte jedoch unbedingt vermieden werden.6
Jod
Jod ist unverzichtbar für die Synthese von Schilddrüsenhormonen und für die fetale Neuroentwicklung. Ein schwerer Jodmangel kann Hypothyreose, Kretinismus und kognitive Entwicklungsstörungen verursachen. In Mitteleuropa tritt Jodmangel heute seltener auf, doch Schwangere und Stillende gehören nach wie vor zu den wichtigsten Risikogruppen. Während gesunde Erwachsene nach WHO-Empfehlung täglich 90–150 µg Jod7 benötigen (die österreichischen Referenzwerte liegen etwas höher bei 180–200 µg), steigt der Bedarf in der Schwangerschaft auf 230 µg, Stillende sollten sogar 260 µg pro Tag aufnehmen. Durch die empfohlene Einnahme von Jodtabletten in einer Dosierung von 100–150 µg lässt sich das Risiko für Entwicklungsstörungen beim Kind verringern.8
Eisen
Der Eisenmangel ist der weltweit am häufigsten auftretende Nährstoffmangel und der führende Auslöser einer Anämie.9, 10 Trotz der hohen Bedeutung des Eisens für den Sauerstofftransport und zahlreiche enzymatische Prozesse ist ein Mangel heute noch unterdiagnostiziert und untertherapiert. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Jugendliche, Frauen vor der Menopause, Schwangere, häufige Blutspender:innen sowie Vegetarier:innen und Veganer:innen. Eisen findet sich in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüse sowie in Fleisch und tierischen Produkten. Pflanzliches Nichthämeisen wird vom Körper schlechter verwertet als das Hämeisen tierischer Herkunft.11Bei der Supplementierung häufig auftretende gastrointestinale Nebenwirkungen ergeben sich durch überschüssiges Eisen im Darm. Niedrigere Tagesdosen (40–60 mg) oder leicht höhere Dosen jeden zweiten Tag (80–100mg) verbessern die Compliance deutlich. Neuere Präparate wie Eisen(III)-Maltol binden Eisen an Zucker, erhöhen dadurch die Bioverfügbarkeit und verringern freie Eisenionen im Darm. Für besonders vulnerable Patient:innen stellt die intravenöse Gabe eine sicherere Option dar.12–14 Ein weiterer zu beachtender Aspekt bei der Eisensupplementierung ist das Darmmikrobiom. Studien legen nahe, dass übermäßige Eisenmengen die Darmflora negativ beeinträchtigen können und dadurch langfristig Risiken bergen. Deshalb sollte eine Supplementierung nur bei einem diagnostizierten Eisenmangel oder einer vorliegenden Eisenmangelanämie erfolgen.15
Zink
Zink ist ein essenzielles Spurenelement, das an über 300 Enzymen und rund 1.000 Transkriptionsfaktoren beteiligt ist.16 Es wirkt antiinflammatorisch und antioxidativ und spielt eine entscheidende Rolle für die Funktionen von angeborener und adaptiver Immunität.17 Da es kein Speicherorgan für Zink gibt, ist die kontinuierliche Aufnahme über die Nahrung erforderlich. Die Referenzwerte hängen stark von der individuellen Ernährung ab, da Phytate in pflanzlichen Lebensmitteln die Aufnahme vermindern. Männer benötigen abhängig von der Phytatzufuhr zwischen 11 mg und 16 mg Zink pro Tag, Frauen zwischen 7 mg und 10 mg. Während der Schwangerschaft und Stillzeit steigt der Bedarf auf bis zu 14 mg.18
Vitamin C
Vitamin C wird meist in ausreichender Menge über die Nahrung aufgenommen, ist aber dennoch ein beliebtes Supplement zur Immunstärkung und kommt deshalb regelmäßig in Beratungsgesprächen vor. Ascorbinsäure kann vom menschlichen Körper aufgrund eines fehlenden Enzyms nicht selbst synthetisiert werden. Die Referenzwerte im D-A-CH-Raum liegen für Männer bei 110 mg/Tag und für Frauen bei 95 mg/Tag. Beim Vorliegen bestimmter Erkrankungen und Infektionen sowie bei chronischem Stress, Rauchen, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, aber auch während der Schwangerschaft und Stillzeit erhöht sich der individuelle Vitamin-C-Bedarf.19 Durch die tägliche Aufnahme von 100–200mg Vitamin C über die Ernährung kann bei gesunden Erwachsenen eine sättigende Plasmakonzentration erreicht und das Risiko chronischer Erkrankungen minimiert werden. Vitamin C ist zwar ein starkes Antioxidans, entscheidend für seine immunmodulierenden Effekte dürfte jedoch vor allem seine Funktion als Kofaktor zahlreicher biosynthetischer und genregulierender Enzyme sein.20
Blasengesundheit
Zusätzlich zu den typischen Atemwegsinfekten im Winter sind vor allem Frauen zu dieser Jahreszeit besonders häufig von Harnwegsinfekten (HWI) betroffen. Patient:innen, die an rezidivierenden HWI leiden, können durch gezielte Maßnahmen das Infektionsrisiko minimieren. In der aktuell gültigen S3-Leitlinie wird empfohlen, vor jeder medikamentösen Langzeitprävention ein ausführliches Beratungsgespräch zur Vermeidung von Risikoverhalten zu führen. Hierzu gehören beispielsweise eine erhöhte tägliche Flüssigkeitszufuhr, regelmäßiges Harnlassen und die Vermeidung von Unterkühlung. Sollte es dennoch zu einer Infektion kommen, können zur unterstützenden Behandlung pflanzliche Harnwegsdesinfizienzien, etwa Bärentraubenblätter, Brunnenkressekraut oder Meerrettichwurzel, empfohlen werden. Letztere beiden eignen sich auch zur Langzeittherapie für die Dauer von über einem Monat.21