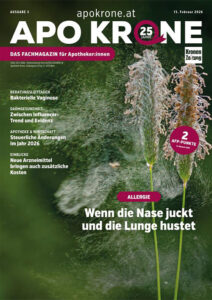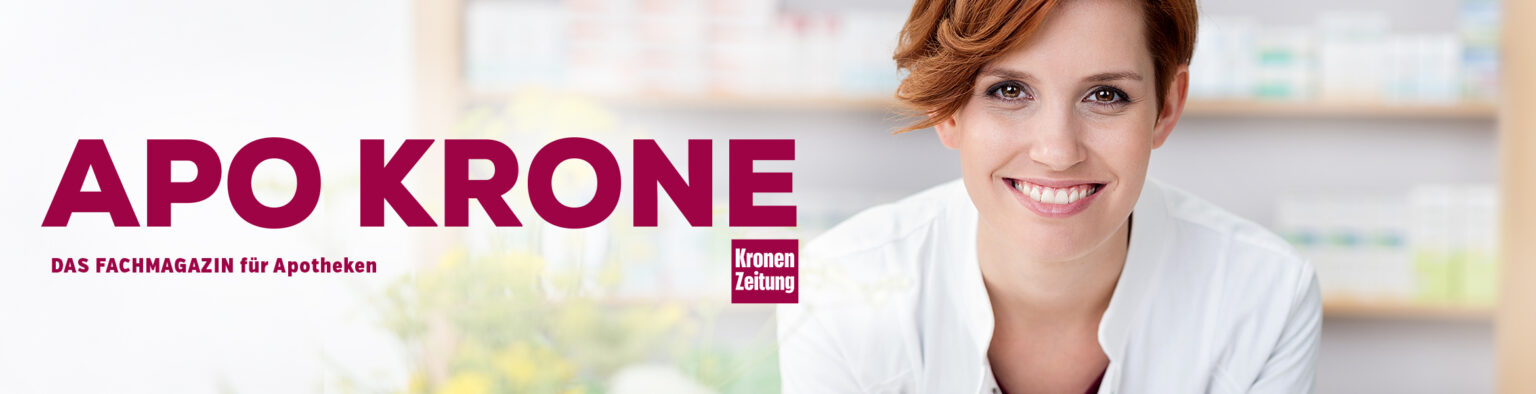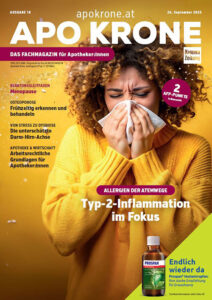Das Darmmikrobiom umfasst mehr als 100 Billionen Bakterien mit einer Gesamtbiomasse von etwa 1,5kg. Von den über 200 identifizierten Mikrobenstämmen gehören mehr als 90 % der Bakterienarten zu den Stämmen Bacteroidetes (Prevotella, Porphyromonas), Firmicutes (Clostridium, Eubacterium) und Actinobacteria (Bifidobacterium). Weitere bedeutsame Spezies sind Lactobacillus, Streptokokken und Escherichia coli.
Das Darmmikrobiom beeinflusst die Gesundheit maßgeblich, wobei mikrobielle Dysbiosen zur Pathogenese verschiedener Erkrankungen beitragen können. Eine zentrale Funktion erfüllt das Mikrobiom bei der Energie- und Stoffwechselregulation, indem es dem Organismus etwa 10 % der aufgenommenen Kalorien bereitstellt. Die Bakterien sind an der Fermentation der Nahrungsbestandteile beteiligt und produzieren dabei Metaboliten sowie kurzkettige Fettsäuren, die antiinflammatorische Eigenschaften aufweisen und zur intestinalen Homöostase beitragen.1
Der „durchlässige“ Darm
Der gesunde Gastrointestinaltrakt erfüllt eine essenzielle Barrierefunktion, indem er zwischen kommensalen Mikroorganismen, pathogenen Keimen, Nährstoffen und inflammatorischen Substanzen differenziert.1 Psychologischer Stress kann erhebliche Auswirkungen auf das Darmmikrobiom haben und eine Dysbiose sowie eine verminderte bakterielle Diversität fördern. Stresssignale werden an den Darm weitergeleitet, wobei der häufig mit Stress einhergehende erhöhte Entzündungszustand eine Vermehrung pathogener Bakterien auslöst. Dies verstärkt die Dysbiose und kann zu einem „leaky gut“ führen.2 Bei dieser Funktionsstörung der intestinalen Epithelbarriere kommt es durch Veränderungen in der Funktion und/oder der Expression von Tight-Junction-Proteinen zu einer erhöhten Permeabilität. Diese Störung wird sowohl mit gastrointestinalen Erkrankungen als auch mit systemischen Krankheiten wie Diabetes mellitus assoziiert. Die Pathogenese des „leaky gut“ ist bislang noch nicht genau geklärt. Es gibt jedoch genetisch prädisponierte Personen, bei denen eine Veränderung der Immunantwort durch verschiedene Umweltfaktoren ausgelöst wird.1 Was das Darmmikrobiom jedoch noch mehr beeinflusst als die Genetik, ist die Ernährung.2 Zu den Umweltrisikofaktoren zählt allgemein die als „westlich“ bezeichnete Ernährung in einkommensstarken Ländern. Diäten mit hohem Gehalt an Saccharose, raffinierten Kohlenhydraten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren sowie geringem Ballaststoffanteil sind mit einem erhöhten Risiko für Darmerkrankungen verbunden.1
Weniger Stress durch Probiotika
Ein stressiger Alltag begünstigt ungesunde Ernährungsmuster. Funktionelle Neuroimaging-Studien zeigen, dass Stress die exekutive Kontrolle bei der Konfrontation mit Nahrungsreizen reduziert und eine Präferenz für hochkalorisches „comfort food“ induziert. Gleichzeitig führt Stress zu Veränderungen der Zusammensetzung des Mikrobioms, die wiederum das Verlangen nach spezifischen Nahrungsmitteln beeinflusst.1 Doch die Beziehung zwischen psychischem Stress und dem Mikrobiom ist bidirektional. Die Einnahme probiotischer Nahrungsergänzungsmittel verbesserte bei japanischen Medizinstudent:innen Schlafqualität, autonome Balance sowie Darmfunktion und reduzierte Stress- und Kortisolspiegel. Eine weitere Untersuchung zeigte, dass der Konsum probiotikahaltiger, fermentierter Milchprodukte bei gesunden Frauen die Aktivität in emotionalen und sensorischen Hirnregionen bei emotionalen Stimuli verminderte.2
Nachhaltig gesund
Die Supplementierung mit Probiotika kann begleitend oder nachfolgend zu einer Antibiotikatherapie, bei Diarrhö oder bei empfindlicher Darmflora durchaus positive Effekte erzielen. Für die langfristige Aufrechterhaltung eines gesunden Mikrobioms ohne kontinuierliche Nahrungsergänzung erweist sich jedoch bereits eine ausgewogene Ernährung als ausreichend wirksam. Eine pflanzenbasierte, ballaststoffreiche Diät mit einem hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren (wie beispielsweise die Mittelmeerdiät) fördert eine gesunde Darmflora, während der übermäßige Konsum tierischer Proteine, gesättigter Fette und Monosaccharide dysbiotische Veränderungen begünstigt.2 Im Folgenden wird genauer auf ausgewählte Nährstoffe und deren konkrete Effekte eingegangen.
Makronährstoffe
Makronährstoffe üben unterschiedliche Effekte auf das Darmmikrobiom aus. Fermentierbare Ballaststoffe fungieren als wichtige Modulatoren bei der Darmfloravielfalt. Sie fördern das Wachstum gesundheitsfördernder Bakterien wie Bifidobacterium, Lactobacillus sowie Prevotella und reduzieren häufig das Firmicutes-Bacteroidetes-Verhältnis. Ein erhöhtes Firmicutes-Bacteroidetes-Verhältnis korreliert mit einem höheren Körpergewicht, da Firmicutes-Spezies eine effizientere Energieextraktion aus der Nahrung aufweisen und somit die Kalorienausbeute steigern. Bei normalgewichtigen Personen zeigt sich häufig ein ausgeglicheneres Verhältnis oder ein höherer Anteil von Bacteroidetes, die durch vermehrte Ausscheidung von Kohlenhydratüberschüssen charakterisiert sind.
Die Fettaufnahme moduliert sowohl quantitativ als auch qualitativ das Firmicutes-Bacteroidetes-Verhältnis und beeinflusst gesundheitsfördernde sowie pathogene Mikroorganismen. Eine hohe Zufuhr von Gesamtfett und gesättigten Fettsäuren wirkt sich negativ auf die mikrobielle Diversität aus und erhöht das Firmicutes-Bacteroidetes-Verhältnis. Ungesättigte Fettsäuren hingegen steigern das Vorkommen von Akkermansia sowie Bifidobacterium und reduzieren schädliche Bakterien wie Streptokokken und E. coli.Art und Menge der Proteinzufuhr beeinflussen die Darmflora maßgeblich. Molkenprotein zeigt in niedrigen Konzentrationen bifidogene Effekte, während hohe Mengen gegenteilige Wirkungen hervorrufen können. Tierische Proteine können das Risiko für intestinale Entzündungen erhöhen, während pflanzliche Proteine die Zusammenstellung des Mikrobioms positiv modulieren.
Mikronährstoffe
Vitamine spielen eine wichtige Rolle bei der Modulation des Darmmikrobioms. Vitamin A moduliert wichtige Mikroorganismen wie Bifidobacterium und Lactobacillus. Eine Überversorgung sollte jedoch vermieden werden. B-Vitamine werden teilweise vom Darmmikrobiom selbst synthetisiert, können jedoch auch die Kolonisation und Virulenz potenziell pathogener Mikroorganismen fördern. Vitamin C korreliert positiv mit Firmicutes und Clostridium-Spezies, während es negativ mit Bacteroidetes assoziiert ist. Es kann das Mikromilieu der Darmflora stabilisieren und die Proliferation von Lactobacillus und Bifidobacterium unterstützen.
Eine Vitamin-D-Supplementierung beeinflusst Gattungen wie Ruminococcus und Faecalibacterium, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, sowie die bakterielle Diversität positiv. Zusätzlich kann sie das Firmicutes-Bacteroidetes-Verhältnis reduzieren und wirkt immunmodulatorisch. Vitamin E wirkt antioxidativ und ist mit einer Zunahme von Bacteroidetes sowie einer Reduktion von Proteobacteria und Firmicutes verbunden. Es kann zudem das Firmicutes-Bacteroidetes-Verhältnis verringern.3