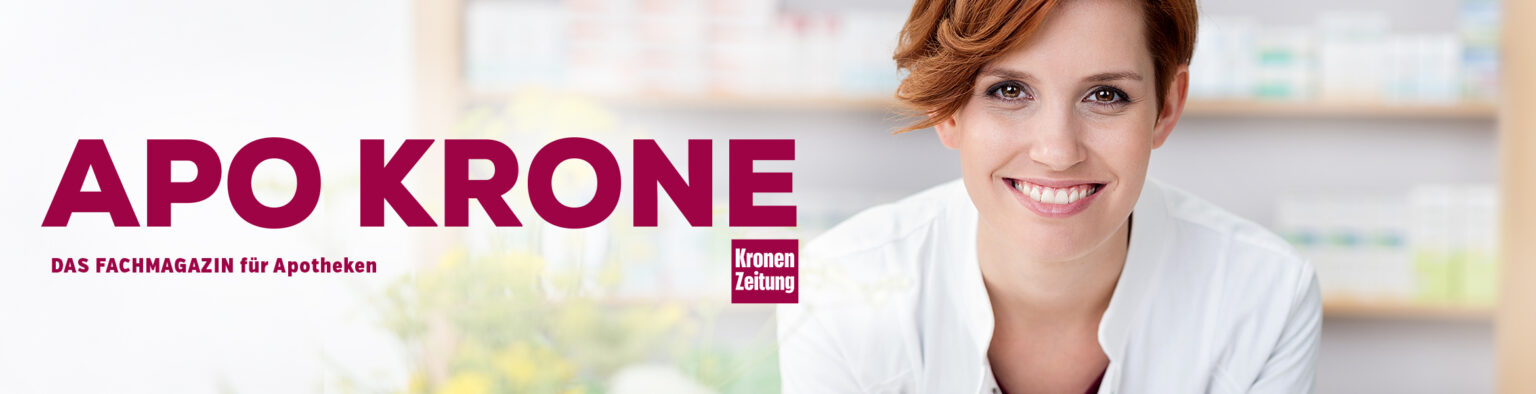Laut Depressionsbericht Österreich aus 2019 leiden 6,5 % der erwachsenen österreichischen Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer depressiven Erkrankung, wobei Frauen davon häufiger betroffen sind.1 Bei der Beratung zur medikamentösen Therapie sind frühzeitiges Erkennen kritischer Kombinationen, substanzklassenspezifische Beratung zu Nebenwirkungen und Empathie entscheidend.
Serotoninsyndrom
Durch erhöhte Konzentrationen von Serotonin im synaptischen Spalt kann das Serotoninsyndrom entstehen. Dieses kann mild bis lebensbedrohlich verlaufen und äußert sich zunächst durch Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Tremor und Unruhe. Die wichtigste Risikokombination sind MAO-Hemmer, die mit fast allen serotonergen Wirkstoffen interagieren. Dies gilt als absolute Kontraindikation, und die Wash-out-Zeit ist laut Fachinformation bei der Umstellung dringend zu beachten. Weitere Risikokombinationen sind selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) mit: Triptanen, Tramadol und Tapentadol, Johanniskraut, Linezolid, Dextromethorphan. Auch Alkohol verstärkt die Bildung und Freisetzung von Serotonin, weshalb der Konsum während einer antidepressiven Therapie zu vermeiden ist.
QT-Zeit-Verlängerung
Unter den SSRI ist das Risiko für eine QT-Verlängerung bei Citalopram und Escitalopram am höchsten. Doch auch andere Antidepressiva verlängern das Intervall, weshalb regelmäßige EKG-Kontrollen im Verlauf der medikamentösen Therapie essenziell sind. Kritische Kombinationen bestehen unter anderem zwischen Antidepressiva und Antiarrhythmika, Makrolid-Antibiotika, Domperidon sowie Ondansetron. Risikofaktoren für eine QT-Zeit-Verlängerung sind weibliches Geschlecht, Bradykardie und Elektrolytstörungen.
CYP-Enzyme
Die Induktion oder Hemmung bestimmter CYP-Enzyme ist bei einer medikamentösen antidepressiven Therapie unbedingt zu beachten. Antidepressiva können sowohl Substrate als auch Inhibitoren oder Induktoren von Cytochrom-P450-Enzymen sein. Starke CYP2D6-Inhibitoren sind Bupropion, Duloxetin, Paroxetin, Fluoxetin und Norfluoxetin. Sie verstärken Wirkung oder Toxizität der Substrate wie Betablocker, Antiarrhythmika, Opioide, Tamoxifen und Risperidon. Die reduzierte Aktivierung von Tamoxifen ist onkologisch besonders relevant. Fluvoxamin ist ein CYP3A4-, CYP1A2-, CYP2C8- und CYP2C9-Inhibitor. Betroffene Substrate sind Kalziumkanalblocker, Statine, Benzodiazepine und Immunsuppressiva. Erhöhte Plasmaspiegel und Toxizitätsrisiken sind zu befürchten.