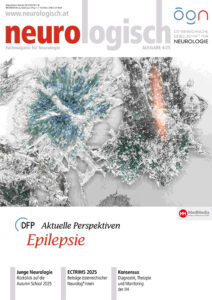Preisregelung für Arzneimittel bleibt
 Motivbild © Krakenimages.com - stock.adobe.com
Motivbild © Krakenimages.com - stock.adobe.com Im Gesundheitsausschuss des Nationalrates wurden am Dienstag weitreichende Entscheidungen in die Wege geleitet – unter anderem in Sachen Arzneimittelpreise und Gesundheitsvorsorge.
Insgesamt drei Ziele verfolgt die von der Regierung im Gesundheitsausschuss des Nationalrates vorgeschlagene Novellierung des ASVG: die Festsetzung eines Preisbandes für wirkstoffgleiche Arzneispezialitäten im Zeitraum 2027 und 2029, die Verlängerung der Regelung zur Preisbildung von Generika und Biosimilars sowie der Richtlinien über die Abgabe parallel importierter Heilmittel. Wie bereits in vorangegangenen Jahren soll im Hinblick auf die Aufnahme in den Erstattungskodex auch 2027 und 2029 ein Preisband für wirkstoffgleiche Arzneispezialitäten festgelegt werden. Die Regelungen, die einen wichtigen Beitrag zur Planungs- und Versorgungssicherheit leisten werden, seien das Ergebnis „harter Verhandlungen“, hob Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hervor.
Vor einer weiteren Einschränkung der Versorgung warnte Gerhard Kaniak (FPÖ), der von einem „Kollateralschaden für die Vertriebskette“ sprach. Die Pharmaunternehmen hätten nämlich nur noch die Möglichkeit, die Preise zu senken oder aus dem Kostenerstattungssystem herauszufallen. Viele Medikamente würden mittelfristig dann komplett vom Markt verschwinden, gab er zu bedenken. Außerdem würden aufgrund des Kostendrucks wohl eher Billigstanbieter aus China profitieren, aus deren Abhängigkeit man sich eigentlich lösen wollte.
Ralph Schallmeiner von den Grünen sprach sich ebenso gegen die Verlängerung des Preisbandes aus, da keine zusätzlichen Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Es werde daher eine Belastung auf die Sozialversicherungen zukommen, die „sich gewaschen habe“. Es bräuchte generell ein neues Modell, das „fair, transparent und nachhaltig“ sei, betonte Schallmeiner, der zudem eine Verkürzung der Verlängerung der Maßnahmen auf zumindest zwei Jahre vorschlug.
Die ursprünglich für Anfang 2026 geplante Ablöse des „gelben Papierheftes“ durch den elektronischen Eltern-Kind-Pass verzögert sich und wird auf den 1. Oktober 2026 verschoben. Grundsätzlich soll der Eltern-Kind-Pass (EKP), der bis Ende 2023 als Mutter-Kind-Pass bezeichnet wurde, die Früherkennung von gesundheitlichen und psychosozialen Risikofaktoren von Müttern und deren Kindern ermöglichen. Bei der digitalen Variante des EKP stehe wiederum das Ziel im Vordergrund, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesundheitsdiensteanbietern und auch die Zuweisung zu diversen Unterstützungsangeboten (z. B. Frühe Hilfen) zu erleichtern. Die nun von der Regierung vorgelegte Novelle sieht nun im Konkreten vor, dass erst ab dem 1. Oktober 2026 alle neu festgestellten Schwangerschaften ausschließlich in elektronischer Form dokumentiert werden – und nicht wie geplant ab 1.1.2026. Außerdem sollen erstmals ab 1. März 2027 die Daten zu den Kindern, die ab diesem Tag geboren werden, elektronisch gespeichert werden. Durch den Beschluss im Gesundheitsausschuss werde nur die technische Umsetzung des EKP in die Wege geleitet, erläuterte Königsberger-Ludwig, der genaue Umfang, die Art und der Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchungen und der Hebammenberatungen sollen mittels Verordnung festgelegt werden. (rüm)