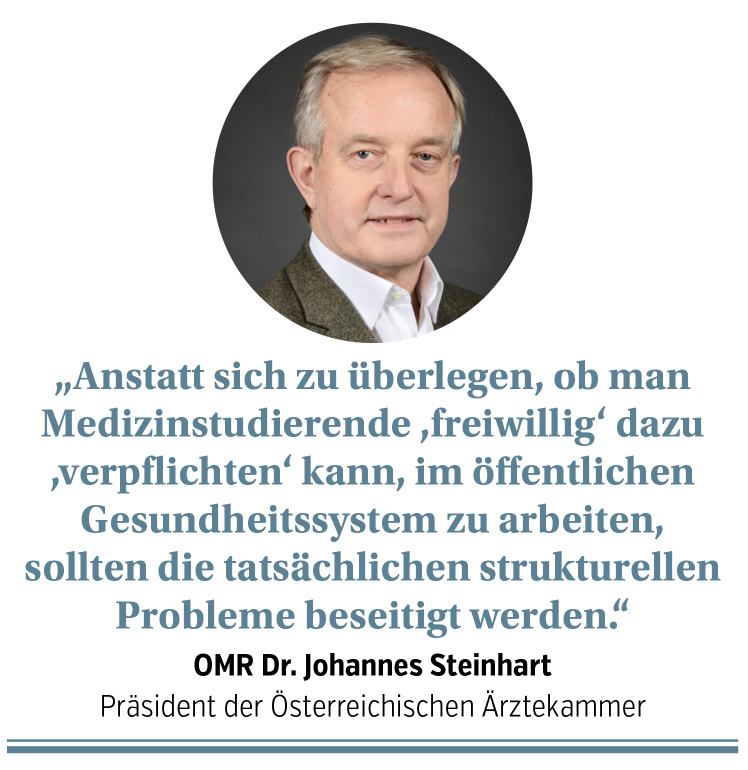Das Ringen um die Versorgungspflicht der Ärzt:innen
„Um die medizinische Versorgung in den Regionen unseres Landes auch in Zukunft sicherzustellen, braucht es ausreichend Ärzt:innen. Daher vergeben wir blau-gelbe Landarztstipendien, mit denen wir Studierende fördern, die nach ihrem Uni-Abschluss als Allgemeinmediziner:innen in Niederösterreich tätig sind.“ Diese Ankündigung des zuständigen niederösterreichischen Landesrates stammt vom Juni des Vorjahres, und sie ist symptomatisch: Ob mit finanziellen Anreizen oder dem jüngsten Vorschlag, Bewerber:innen für ein Medizinstudium zu bevorzugen, wenn sie nach Abschluss im öffentlichen System tätig sind – die Suche nach einer Möglichkeit der Verpflichtung von Ärzt:innen ist nicht nur im Gange, sie nimmt zunehmend konkretere Züge an.
Neues Gutachten
Angeheizt hat die Debatte kürzlich der Medizinrechtler Karl Stöger (Uni Wien), der eine „freiwillige Verpflichtung“ von Medizinstudent:innen, etwa über eine Landarztquote, grundsätzlich für möglich hält. Stöger hat ein entsprechendes Gutachten im Auftrag der Arbeiterkammer erstellt. Die wichtigsten Ergebnisse: Eine zunächst wie ein Widerspruch klingende „freiwillige Verpflichtung“ würde dann vorliegen, wenn Studienwerber:innen sich im Gegenzug für einen bevorzugten Zugang zum öffentlich finanzierten Studium verpflichten, nach dem Abschluss für eine bestimmte Zeit in einem Bereich des öffentlichen Gesundheitssystems zu arbeiten. Ein solches System gibt es bereits: Laut Universitätsgesetz können bis zu 5 % der Studienplätze „für Aufgaben im öffentlichen Interesse“ gewidmet werden. Davon macht zum Beispiel das Bundesheer bereits Gebrauch. Die Studienwerber:innen für diese Plätze haben insofern einen bevorzugten Zugang, als dass sie nicht dem eigentlichen Auswahlverfahren um die besten Testergebnisse unterliegen, sondern nur 75 % der Punkteanzahl aller angetretenen Bewerber:innen erreichen müssen.
Praktische Umsetzung
Dieses System könnte auch auf das Medizinstudium umgelegt werden, so der Experte – allerdings in bestimmten Grenzen. So dürften nur so viele Plätze für eine freiwillige Selbstverpflichtung gewidmet werden, als später im öffentlichen Gesundheitswesen benötigt werden. Die Quote dürfe zudem auch nicht als Ersatz für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung für Ärzt:innen im öffentlichen System dienen. Weiters dürfe die Verpflichtungsdauer nicht zu lang sein – in Deutschland beträgt sie etwa 10 Jahre nach Ende der Ausbildung. Last, but not least seien bei der Festlegung einer Pönalzahlung für den Fall einer Verletzung der Verpflichtung ebenfalls Grenzen einzuhalten.
Der jüngste Vorschlag ist Wasser auf die Mühlen all jener, die sich schon seit längerem für eine verpflichtende Tätigkeit von Mediziner:innen im solidarischen Gesundheitssystem aussprechen. Andreas Huss, Arbeitnehmer:innen-Obmann der ÖGK: „Zuletzt haben die Medizin-Universitäten immer wieder gemeldet, dass sie nur 10 Prozent der Bewerber:innen aufnehmen konnten, gleichzeitig können manche Kassenstellen nicht besetzt werden. Hier zeigt sich ein immenser Reformstau.“ Und weiter: „Wir müssen diejenigen bevorzugen, die in der Versorgung für alle Menschen und ohne private Zuzahlungen mithelfen wollen. Daher brauchen wir vor dem Studium eine freiwillige Verpflichtung nach der Ausbildung, zumindest für 10 Jahre im öffentlichen System zu bleiben. Die, die sich verpflichten, sollen zuerst die verfügbaren Studienplätze bekommen, erst danach jene, die eine Karriere in der Privatmedizin bevorzugen oder sich nicht verpflichten wollen.“ Um den Hausärztenachwuchs zu sichern, sollten zudem zusätzliche Ausbildungsplätze mit Auflagen speziell für Allgemeinmediziner:innen eingerichtet werden. In Deutschland werde diese Vorgangsweise mit der Landarztquote bereits vorgelebt, erklärt Huss.
Kampfansage an Ärzteschaft
Für die Ärztekammer ist der aktuelle Vorstoß wenig überraschend eine Kampfansage. „Anstatt sich zu überlegen, ob man Medizinstudierende ‚freiwillig‘ dazu ‚verpflichten‘ kann, im öffentlichen Gesundheitssystem zu arbeiten, sollten die tatsächlichen strukturellen Probleme beseitigt werden“, kommentiert OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK). Noch deutlicher wird Dr. Harald Mayer, ÖÄK-Vizepräsident und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzt:innen. Verpflichtungen für Absolvent:innen des Medizinstudiums auch nur anzudenken, zeuge nicht gerade von Kreativität und Realitätssinn: „Wer Zwang verspürt, wird in keinem Beruf der Welt mit Freude zur Arbeit gehen, und es macht es auch nicht besser, wenn man das Ganze mit dem Feigenblatt der im Gutachten genannten ‚freiwilligen Verpflichtung‘ zu tarnen versucht.“
Wettlauf im Wahlkampf
So oder so – das Thema wird im laufenden Nationalratswahlkampf weiter an Fahrt aufnehmen. Schließlich zählt die gesicherte Gesundheitsversorgung zu den größten Sorgen der Patient:innen und damit der Wähler:innen. Nicht zuletzt war der Ausgangspunkt des aktuellen Gutachtens die Forderung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) aus dem vergangenen Jahr, Mediziner:innen nach ihrem Studium eine gewisse Zeit lang eine Art Berufspflicht aufzuerlegen. Sie sollten „der Gesellschaft ein Stück weit etwas von dem zurückzugeben, was sie kostenlos in Anspruch genommen haben“, monierte der Kanzler. SPÖ-Chef Andreas Babler wiederum plädiert für eine zweistufige freiwillige Verpflichtung im Gegenzug für einen bevorzugten Zugang: Studierende würden sich demnach einmal zu Beginn des Studiums und einmal am Ende verpflichten, im öffentlichen Gesundheitssystem als Ärzt:in zu arbeiten – wobei beim zweiten Mal die konkreten Fächer gewählt werden sollten, in denen es in absehbarer Zeit Bedarf gibt.