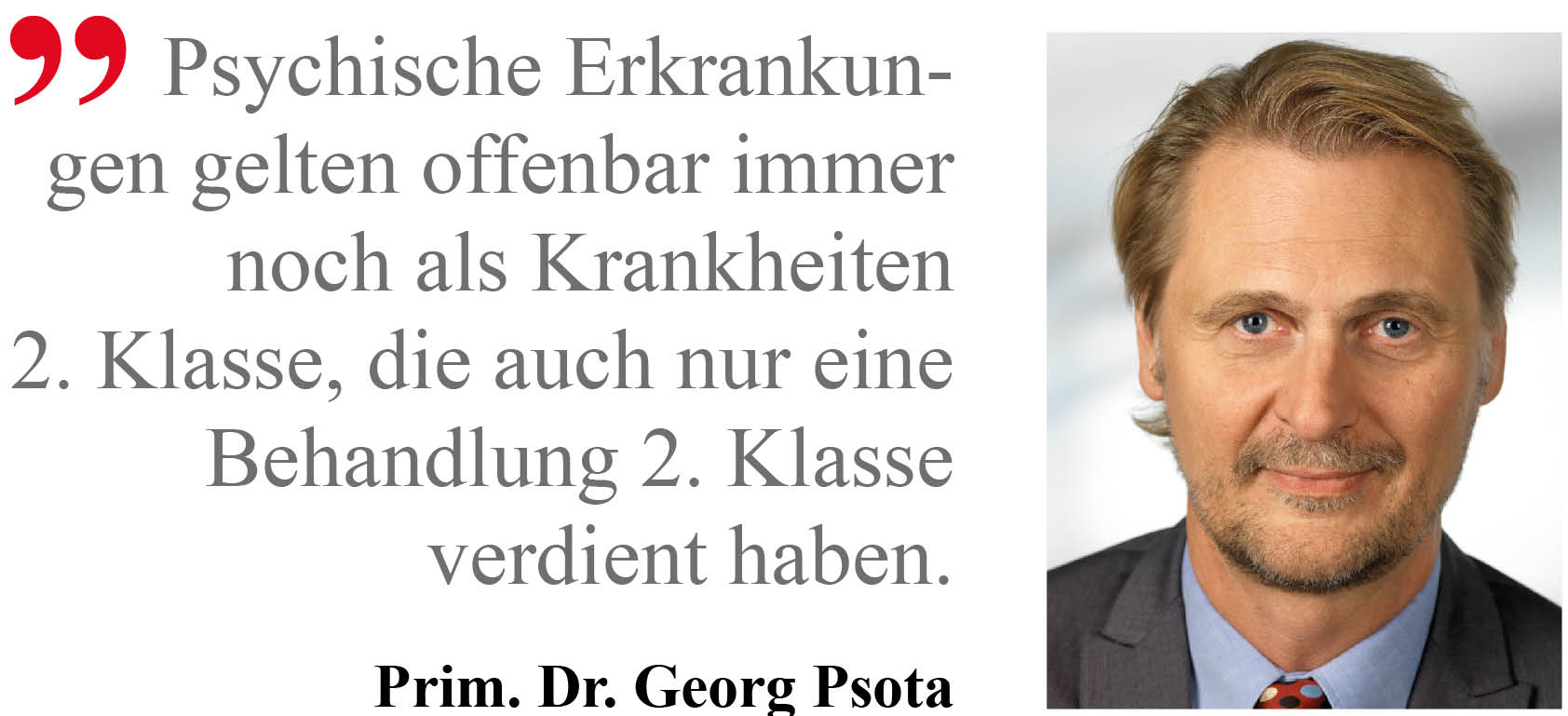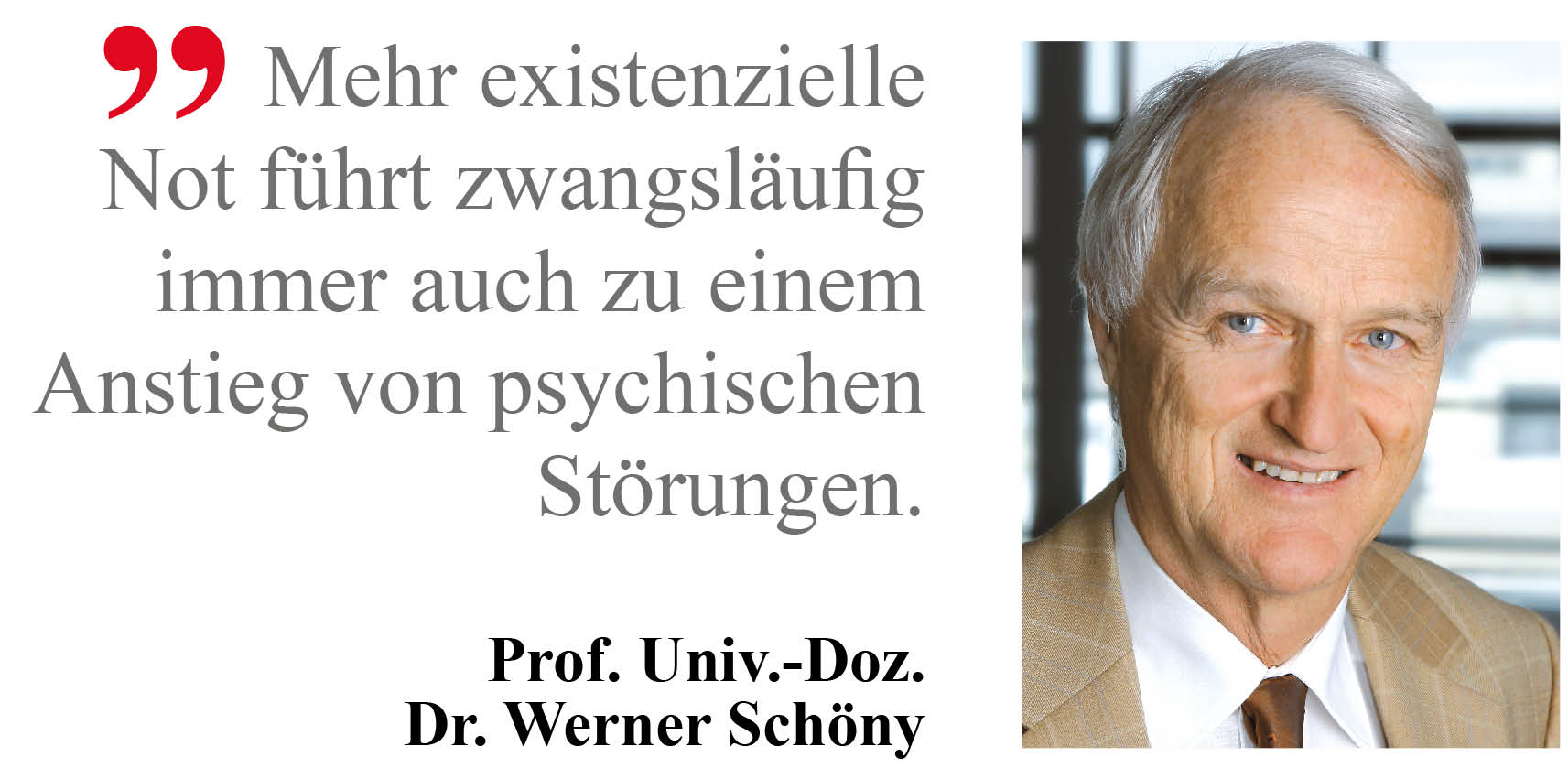Psychiatrie: Sparzwang gefährdet Therapieerfolge
„In Österreich akzeptieren wir, wenn es um die Versorgungssituation psychisch Kranker geht, seit Jahren Entwicklungen, die bei jedem anderen Krankheitsbild als inakzeptabel gelten würden. Offenbar gelten psychische Erkrankungen immer noch als Krankheiten 2. Klasse, die auch nur eine Behandlung 2. Klasse verdient haben“, so Chefarzt Prim. Dr. Georg Psota, Past-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. „Zusammengefasst kann man die Art und Weise, wie wir mit psychiatrischen Patienten umgehen, nur als nicht zeitgemäß bezeichnen: Ich fürchte, das werden wir erst in 10 Jahren erkennen und rückblickend bedauern.“In den europäischen WHO-Staaten erkrankt einer von 15 Menschen pro Jahr an einer schweren Depression. Angststörungen und leichtere Depressionsformen eingerechnet, sind es 4 von 15. Von Suchterkrankungen abgesehen, sind Frauen häufiger betroffen als Männer: 33,2 vs. 21,7%.
In den WHO-Berechnungen zur „Krankheitslast“ rangieren in unseren Breiten bereits jetzt Depressionen und Suchterkrankungen unter den Top 5. Bis 2030 wird die Depression die neue Nummer 1, und Demenzerkrankungen und Süchte folgen bald danach – dann werden 3 psychische Krankheitsbilder unter den Top 5 aufscheinen. Psota: „Derzeit ist die psychiatrische Versorgungslage in Österreich so, dass wir gerade noch das Notwendige schaffen.“
Einige Beispiele:
- Während etwa in der Schweiz 30 Psychiater pro 100.000 Einwohner zur Verfügung stehen, gibt es in ganz Österreich weniger als 150 mit einem Kassenvertrag. Wer nicht zusatzversichert oder reich ist, muss sich einen Kassenplatz mit rund 55.000 anderen teilen.
- Von den rund 900.000 Patienten, die in Österreich mit Antidepressiva versorgt werden, sind nicht einmal 15% in einer psychotherapeutischen Behandlung.
- Derzeit stehen für 100.000 Einwohner je nach Bundesland nur 35 bis 55 Psychiatrie-Betten bereit – damit liegt Österreich im europäischen Vergleich am unteren Ende der Skala. Zu wenig ausgebaute ambulante Behandlungsstrukturen bedeuten oft unzumutbare Wartezeiten.
- Neuere Medikamente werden seit Jahren nicht routinemäßig erstattet.
Medikamentöse Therapieoptionen werden vorenthalten
In den vergangenen Jahren wurden neue Antidepressiva entwickelt, die auf dem melatoninähnlichen Wirkstoff Agomelatin basieren. Mit Nalmefen, einem Opioidantagonisten, kam ein neues Präparat für Alkoholkranke auf den Markt, mit neuen Asenapin-Medikamenten lassen sich manische Phasen bei Patienten mit bipolaren Störungen sehr gut behandeln. Und Paliperidon, ein weiteres neues Antipsychotikum, hat sich in der Behandlung von Schizophrenien bewährt. „Alle diese neuen Medikamente haben eines gemeinsam: Sie sind in Österreich zwar zugelassen, werden von den Krankenkassen aber nicht routinemäßig erstattet“, so Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Fleischhacker, Geschäftsführender Direktor des Departments Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Medizinische Universität Innsbruck. „Für den Großteil der Patienten heißt das: Ihnen werden Therapieoptionen, die in unseren Nachbarländern verfügbar sind, schlicht und einfach vorenthalten.“
„Minimal-Einsparungen wird hier ein möglicher Therapieerfolg geopfert“, so Fleischhacker: „Die Behandlung von Patienten mit Depressionen mit einem ebenfalls neuen Antidepressivum (Vortioxetin) würde 37 Euro pro Monat kosten, auf ein Jahr hochgerechnet rund 450 Euro. Das ist nicht einmal ein Zwanzigstel der Kosten, die für die medikamentöse Behandlung anderer chronischer Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder die Schuppenflechte ganz selbstverständlich aufgebracht werden.“
Es wird immer wieder vorgebracht, die neuen Präparate seien nicht innovativ genug, weil es bereits andere Präparate mit gleicher Wirkung gebe. „Das Prinzip ‚one size fits all‘ funktioniert nirgendwo in der Medizin“, so Fleischhacker. „Es gibt viele Patienten, die auf manche der verfügbaren Medikamente nicht oder nur unzureichend ansprechen, denen die neuen Wirkstoffe aber effizient helfen könnten. Zudem haben etliche der neuen Präparate Vorteile im Nebenwirkungsprofil.“Leider würden Therapiebemühungen in der Psychiatrie immer noch nicht wirklich ernst genommen werden, konstatiert Fleischhacker: „Kurz gesagt: Offenbar ist es trotz jahrzehntelanger Aufklärung immer noch nicht gelungen, klar zu machen, dass psychische Krankheiten nicht anders gesehen werden dürfen als körperliche Leiden.“
Auch die Wirtschaft leidet: Gesamt gesehen sind die direkten Kosten für Behandlung und Pflege in der Psychiatrie geringer zu veranschlagen als indirekte Kosten z.B. für Krankenstände, vermindertes Einkommen und Frühpensionierungen. Für Österreich hat das „Institut Wirtschaftsstandort Oberösterreich“ die indirekten Folgekosten psychischer Erkrankungen in einer 2014 erstellten Studie mit rund 7 Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt – ohne rasche Gegenmaßnahmen mit stark steigender Tendenz. „Vielleicht liegt gerade in dieser prekären Finanzaussicht auch eine Chance zur Trendwende“, so Fleischhacker. „Eine aktuelle WHO-Studie zeigt, dass jedem in die psychiatrische Versorgung investierten Euro vier Euro durch erhöhte Produktivität und Einsparungen bei anderen Gesundheitskosten gegenüber standen.“
Gute Sozialpolitik ist beste Prävention
„Selbstverständlich gilt auch in der Psychiatrie: Vorbeugen ist besser als heilen“, sagt Prof. Univ.-Doz. Dr. Werner Schöny, Präsident von pro mente Austria. „Leider ist das gerade in unserer Disziplin extrem schwierig. Es gibt nun einmal keine Impfung für die seelische Gesundheit. Umso wichtiger ist es, möglichst viele Risikofaktoren auszuschalten, die psychische Störungen begünstigen. Sinnvolle Prävention gegen psychische Leiden fängt immer mit guter Sozialpolitik an.“Wer die Integration ins Erwerbsleben fördert sowie Armut und soziale Diskriminierung abbaut, nennt Schöny ein Beispiel, sorgt ganz automatisch dafür, dass die Zahl psychisch Kranker nicht weiter steigt: „Leider erleben wir gerade das Gegenteil: Auch in Österreich sind immer mehr Menschen armutsgefährdet und müssen unter schlechten sozialen Bedingungen leben.“ So werde etwa in der aktuellen Debatte um die Kürzung der Mindestsicherung völlig übersehen, dass noch mehr existenzielle Not zwangsläufig immer auch zu einem Anstieg von psychischen Störungen führt.
Gerade für Flüchtlinge ist jede Art der Beschäftigung besser als gar keine, sagt Schöny: „Wenn es gelingt, diese Menschen auch nur für einige Stunden einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen zu lassen, werden wir weniger Betreuung und medizinische Intervention für sie brauchen. Arbeiten zu dürfen stärkt das Selbstbewusstsein und gibt dem Alltag Struktur. Menschen, die das Gefühl haben, dass sie ein produktiver Teil der Gesellschaft sind, werden weniger oft psychisch krank.“ Das gilt nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für Menschen, die bereits an psychischen Krankheiten leiden. Schöny: „Es ist nicht immer leicht, diese in ein geregeltes Erwerbsleben zu integrieren. Bei pro mente Austria zeigen wir aber in zahlreichen Projekten, dass es möglich ist.“
Positive Ansätze, aber noch keine Offensive
„Zum Glück gibt es in jüngster Zeit auch einige positive Ansätze, die zeigen, in welche Richtung es gehen muss“, so Psota. So sei es zu begrüßen, dass die Psychiatrie in der Medizinausbildung nun doch deutlich besser positioniert ist und jede Ärztin und jeder Arzt in Zukunft zumindest über ein Grundwissen in dieser Disziplin verfügen wird. Mit der Mangelfachverordnung habe man auch die Möglichkeiten bekommen, sowohl mehr Kinder- und Jugendpsychiater als auch Erwachsenenpsychiater auszubilden. Psota: „Diese Chance müssen wir aber auch nutzen. Bisher sind Schritte zur konkreten Umsetzung noch ausständig.“Nicht zuletzt mache auch eine Initiative der Stadt Wien Hoffnung, die derzeit unter Einbindung internationaler Expertinnen und Experten an einem „Psychiatrisch/psychosomatischen Versorgungsplan 2030“ arbeitet, der eine deutliche Aufwertung der psychiatrischen Versorgung bringen könnte.