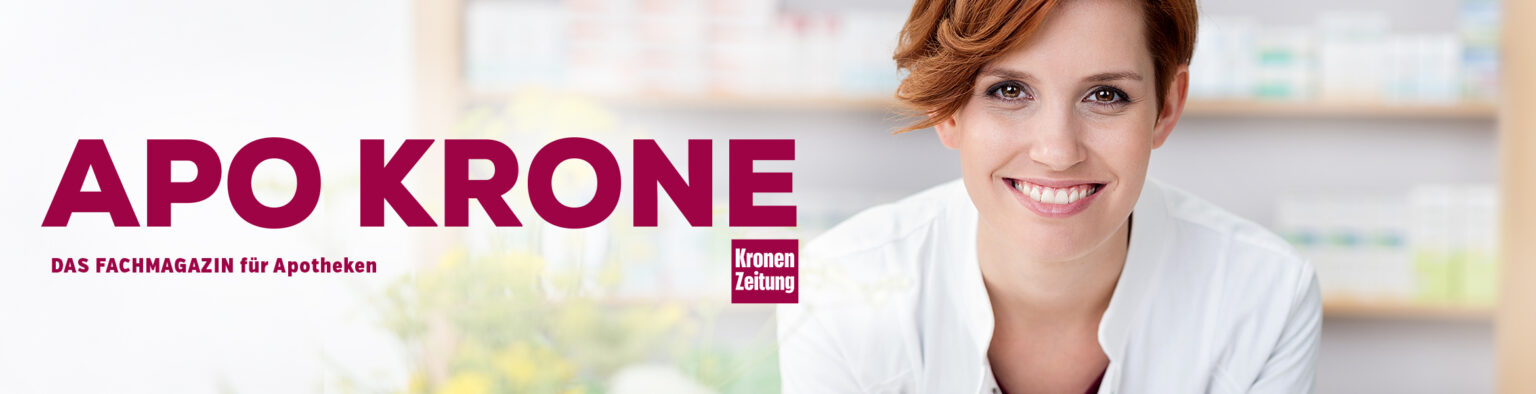Über 50 % aller Erkältungen werden durch Rhinoviren (RV) verursacht. Das macht sie zu den häufigsten viralen Erregern respiratorischer Infektionen. Was für immunkompetente Erwachsene meist eine lästige, aber harmlose Erkrankung bedeutet, kann bei Risikopatient:innen zu erheblichen Komplikationen führen. Da nach heutigem Stand weder eine Impfung noch eine kausale antivirale Therapie zur Verfügung stehen, wird symptomatisch behandelt.
Virologie
Rhinoviren gehören zur Familie der Picornaviridae und haben ein einzelsträngiges, positivsträngiges RNA-Genom, das direkt als mRNA für die virale Proteinsynthese fungiert. Diese molekulare Eleganz ermöglicht schnelle Replikation ohne aufwendige Transkription. Im Gegensatz zu Influenza- oder Coronaviren fehlt Rhinoviren eine Lipidhülle, was sie deutlich stabiler für die Umwelt macht.
Für die Beratung zur Händehygiene bedeutet das: Alkoholische Händedesinfektionsmittel sind hier effektiver als einfaches Händewaschen mit Seife.1 Die zweite Erfolgskomponente ist die enorme antigene Variabilität mit über 150 identifizierten Serotypen. Das erklärt, warum durchschnittlich zwei Infektionen pro Jahr bei Erwachsenen auftreten und warum eine Impfstoffentwicklung bislang erfolglos blieb. Nach Bindung an Epithelzellen des Respirationstraktes über Rezeptoren wie ICAM-1 erfolgt die Replikation im Zytoplasma. Bei immunkompetenten Personen bleibt die Infektion meist auf den Nasen-Rachen-Raum beschränkt und heilt innerhalb von 7 bis 10 Tagen selbstlimitierend ab.2
Risikopatient:innen erkennen
Bei Patient:innen mit Asthma oder COPD führen Rhinovirus-Infektionen in bis zu 50% der Fälle zu schweren Infektionen der unteren Atemwege, etwa 25 % werden durch bakterielle Superinfektionen kompliziert.2 Weitere Risikogruppen sind ältere Menschen über 65 Jahre, Immunsupprimierte, Säuglinge und Patient:innen mit kardialen Vorerkrankungen. Bei diesen Gruppen sollte aktiv nach Warnsignalen gefragt werden. Beim Vorliegen von Red Flags ist eine ärztliche Konsultation unumgänglich. Die virale akute Rhinosinusitis ist jedoch in über 90 % der Fälle selbstlimitierend, und das Komplikationsrisiko bleibt unabhängig vom Antibiotikaeinsatz gering.3 Durch kompetente Beratung können unnötige Antibiotikaverordnungen vermieden und gleichzeitig Patient:innen die Sicherheit gegeben werden, dass symptomatische Therapien bei unkomplizierten Verläufen völlig ausreichend sind.
Medikamentöse Therapie
Die sich derzeit in Überarbeitung befindliche S2k-Leitlinie „Rhinosinusitis“ bietet Orientierung für die symptomatische Behandlung. Topische Dekongestiva wie Xylometazolin oder Oxymetazolin führen durch Vasokonstriktion zur schnellen Abschwellung der Nasenschleimhaut innerhalb weniger Minuten. Die maximale Anwendungsdauer von 7 Tagen darf nicht überschritten werden, da sonst Rhinitis medicamentosa droht. In der Beratung empfiehlt sich die bevorzugt abendliche Anwendung für erholsamen Schlaf sowie der Hinweis auf konservierungsmittelfreie Formulierungen. Bei Kleinkindern ist wegen möglicher paradoxer Reaktionen Vorsicht geboten, ebenso bei Patient:innen mit Hypertonus oder Engwinkelglaukom. Bei Schmerzen sowie erhöhter Temperatur sind Antiphlogistika wie Ibuprofen oder ASS aufgrund ihrer antiinflammatorischen Wirkung dem Paracetamol überlegen. Die Evidenzlage für Sekretolytika wie Acetylcystein oder Ambroxol ist schwach, weshalb die Leitlinie keinen überzeugenden Nutzen bei akuter Rhinosinusitis nachweisen konnte. Topische Kortikosteroide wie Mometason oder Fluticason spielen bei allergischer Komponente oder rezidivierender Symptomatik eine wichtige Rolle. Ihre Vorteile liegen im fehlenden Rebound-Effekt und der Möglichkeit längerfristiger Anwendung, allerdings setzt die Wirkung erst nach 12 bis 24 Stunden ein.4
Nichtmedikamentöse Maßnahmen
Nasenspülungen mit isotonischer Kochsalzlösung zeigen gute Evidenz als additive Therapie und können die Notwendigkeit von Dekongestiva reduzieren. In der Beratung sollte auf die korrekte Anwendung hingewiesen werden: körperwarme isotonische Lösung (0,9 % NaCl), zwei- bis viermal täglich, mit sterilem oder abgekochtem Wasser. Hypertone Lösungen können zusätzlich abschwellend wirken, aber auch Reizungen verursachen. Nasensprays mit physiologischer Kochsalzlösung sind praktisch für unterwegs, während Nasenspülkannen gründlichere Spülungen ermöglichen. Die Inhalation heißer Dämpfe bei 38 °C bis 42 °C zeigte in Studien Symptomlinderung und kann mit klassischer Schüsselmethode oder modernen Inhalatoren durchgeführt werden. Zusätze wie Kamille oder Eukalyptus werden subjektiv oft als angenehm empfunden, bei Säuglingen und Kleinkindern sind ätherische Öle jedoch wegen der Gefahr eines Laryngospasmus kontraindiziert. Weitere sinnvolle Allgemeinmaßnahmen umfassen Luftbefeuchtung, besonders in der Heizperiode, ausreichend Schlaf, körperliche Schonung bei Fieber und Rauchverzicht.4
Phytotherapeutika
Die Leitlinie spricht 2 explizite phytotherapeutische Empfehlungen aus. Der Mischextrakt BNO 1016 aus Enzian, Schlüsselblume, Sauerampfer, Holunder und Eisenkraut zeigte in mehreren klinischen Studien Überlegenheit gegenüber dem Placebo. Auch für standardisierte Eukalyptusextrakte gibt es positive Studiendaten zu antiinflammatorischen und mukolytischen Eigenschaften, allerdings ist wegen möglicher Bronchospasmen Vorsicht bei Kindern unter 2 Jahren und bei Asthmatiker:innen geboten.4