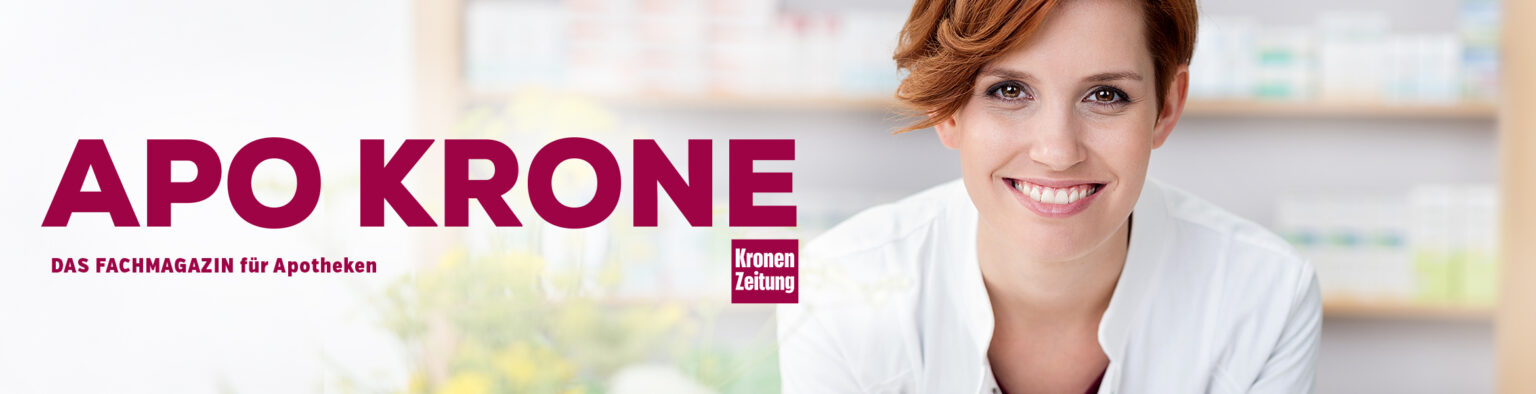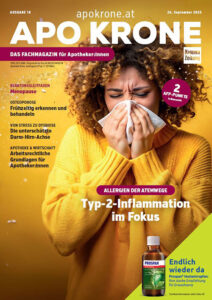Ein- und Durchschlafstörungen, oft begleitet von innerer Unruhe, können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die Ursachen reichen von akuten Stresssituationen über ungünstige Schlafgewohnheiten bis hin zu chronischen Erkrankungen. Eine sorgfältige Anamnese ist entscheidend, um organische oder medikamentenbedingte Auslöser auszuschließen und eine geeignete, individuelle Therapieempfehlung geben zu können.
Zirkadianer Rhythmus
Der etwa 24-stündige biologische Rhythmus fungiert als zentrale Steuerungsinstanz für lebenswichtige Körperfunktionen wie Schlaf, Herz-Kreislauf-Aktivität, Immunreaktion sowie Gedächtnisbildung und Hirnregeneration.1 Eine Desynchronisation dieser inneren Uhr ist ein charakteristisches Problem der modernen Zeit mit gestörten Tag-Nacht-Rhythmen, das in vielfältigen physiologischen Beeinträchtigungen resultiert, zu denen primär Schlafstörungen zählen.2 Melatonin ist ein Hormon, das maßgeblich am zirkadianen Rhythmus beteiligt ist. Es entsteht als Endprodukt der Biosynthesewege von Tryptophan und Serotonin in der Zirbeldrüse. Die endogene Melatoninausschüttung unterliegt komplexen Regulationsmechanismen, die bis heute nicht vollständig geklärt sind. Licht stimuliert die Produktion über neuronale und zelluläre Prozesse. Die Herunterregulierung erfolgt durch mehrere Mechanismen: den Rückzug der Noradrenalinausschüttung aus dem neuronalen Signalweg, die Verringerung zytoplasmatischer sekundärer Botenstoffe, die Hemmung des geschwindigkeitsbestimmenden Enzyms Arylalkylamin-N-Acetyltransferase (AANAT) sowie den verstärkten Abbau von zytoplasmatischem AANAT. Unterschiede in der Regulierung – ausgelöst durch Jahreszeit, Geschlecht, Alter und weitere Faktoren – werden diskutiert.1
Exogenes Melatonin
Die orale Aufnahme von Melatonin kann bei leichten Ein- und Durchschlafproblemen helfen. Es muss jedoch eine relativ hohe Menge eingenommen werden, da die Bioverfügbarkeit durch den First-Pass-Effekt in der Leber bei weniger als 50 % liegt. Positiv hervorzuheben ist, dass bisher weder Toleranzentwicklung noch Sensibilisierung oder Gewöhnung beobachtet wurden. Die Einnahme sollte zwischen 30 und 60 Minuten vor dem Zubettgehen erfolgen, um die Wirkung zur gewünschten Zeit zu entfalten.1
Stressreduktion
Psychische Belastungen setzen zwei zentrale Stresssysteme in Gang: das sympathische Nervensystem und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse.3,4 Sowohl akuter als auch chronischer psychologischer Stress wirken sich in weiterer Folge unter anderem negativ auf die Schlafqualität aus und können Schlaflosigkeit verursachen.5,6 Gezielte Maßnahmen zur Stressreduktion können sich folglich ganzheitlich positiv auf die Gesundheit auswirken. Bewegung, besonders in Form von Yin Yoga, wirkt beispielsweise regulierend auf beide Systeme und mildert deren Aktivierung sowie Reaktionsintensität.4 Ein weiterer, relativ moderner Begriff, der oft im Zusammenhang mit der Stressbewältigung verwendet wird, ist Achtsamkeit (engl. Mindfulness). Die Aufmerksamkeit soll sich auf den gegenwärtigen Moment fokussieren, was die Akzeptanz negativer Emotionen unterstützt und in weiterer Folge die emotionale Regulierung und die Resilienz verbessert. Eine 2023 veröffentlichte Studie beschreibt, dass dieses bewusste Handeln im Hier und Jetzt signifikante, indirekte Auswirkungen auf die Schlafqualität hat.7
Körperliche Aktivität
Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert sowohl die Einschlafzeit als auch die Schlafqualität und -dauer. Darüber hinaus trägt sie zur Regulierung der Körperkerntemperatur, des Stoffwechsels und des zirkadianen Systems bei. Bei der Beratung von Patient:innen mit Ein- oder Durchschlafstörungen ist auf das richtige Timing des Trainings hinzuweisen. Intensives Training sollte mindestens 4 Stunden vor der geplanten Einschlafzeit beendet werden, da hohe Belastungen am Abend kontraproduktiv wirken können. Diese können die Melatoninkonzentration vermindern und zu späterem Einschlafen, kürzerer Schlafdauer sowie geringerer Schlafqualität führen. Leichte Übungen wie Yin Yoga können hingegen auch kurz vor dem Zubettgehen praktiziert werden.8,9
Unterstützende Selbstmedikation
Die wohl bekannteste beruhigend und schlaffördernd wirkende Pflanze ist der Baldrian, dessen Wurzeln traditionell zur Behandlung von nervöser Unruhe und Schlafstörungen eingesetzt werden. Bekannte Nebenwirkungen sind Übelkeit und abdominelle Krämpfe.6,10 Weitere beruhigende Pflanzen sind Passionsblume, Hopfen und Melisse. Zubereitungen mit Passionsblumenkraut können bei Schlaflosigkeit oder Angstzuständen helfen, indem die GABA-Rezeptoren stimuliert werden.3 Dem HMPC sind derzeit keine Nebenwirkungen bekannt. Es erkennt die Wirkung von passionsblumenkrauthaltigen Arzneimitteln zur Behandlung von Schlafstörungen und Unruhezuständen aufgrund des Traditional Use an.11 Ebenfalls keine bekannten Nebenwirkungen weisen Hopfenblüten und Melissenblätter auf. Beide können zur Behandlung von Schlafstörungen und Unruhezuständen eingesetzt werden.12,13 Oft beinhalten Präparate oder Teemischungen eine Kombination der genannten Pflanzen.