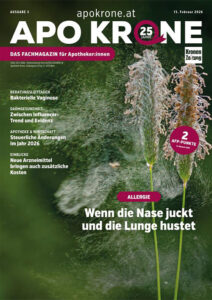Innovationsfähigkeit sichern
Wie es Europa gelingen kann, seine Innovationsfähigkeit langfristig zu sichern, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Grundlagenforschung, praxisnaher Ausbildung und wirtschaftlicher Verwertung, beschreibt Prof. Dr. Carsten Welsch, PhD, Leiter der Beschleunigerforschung an der Universität Liverpool, Direktor des LIV.INNO STFC-Zentrums für Doktorandenausbildung im Bereich datenintensive Wissenschaft und Koordinator des gesamteuropäischen EuPRAXIA-Doktorandennetzwerks. Der international vernetzte Wissenschaftler gibt Einblick in aktuelle Herausforderungen, gelungene Ausbildungsmodelle und notwendige politische Rahmenbedingungen, um Forschungskarrieren zu stärken und Innovationen schneller in die Anwendung zu bringen.
Sie sind seit vielen Jahren in der europäischen Forschungs- und Bildungslandschaft aktiv. Wie würden Sie die aktuelle Situation in Bezug auf die Ausbildung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Europa beschreiben?
Europa hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht, wenn es um hochwertige Doktoranden- und Postdoktorandenausbildung geht – insbesondere durch exzellente Initiativen wie die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen. Dennoch besteht weiterhin ein Bedarf an stärkerer Vernetzung zwischen Wissenschaft und Industrie, insbesondere in innovationsgetriebenen Bereichen wie der Medizintechnik. Programme wie das Liverpool Centre for Doctoral Training for Innovation in Data Intensive Science (LIV.INNO) und das EuPRAXIA Doctoral Network, das ich leite, sind gezielt darauf ausgerichtet, diese Lücke zu schließen, indem sie Forschenden sowohl akademische Tiefe als auch industriebezogene Kompetenzen vermitteln.
Wie gut sind junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ihrer Meinung nach auf die Anforderungen der heutigen Forschungs- und Innovationslandschaft vorbereitet?
Wir erleben derzeit einen der dynamischsten Wandlungsprozesse in der Geschichte der Forschung und Innovation. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden – etwa der Integration von künstlicher Intelligenz (KI), der strategischen internationalen Zusammenarbeit oder der zunehmenden Bedeutung psychischer Gesundheit –, müssen wir unsere strukturierten Ausbildungsprogramme entsprechend weiterentwickeln. Besonders hilfreich sind für mich regelmäßige Gespräche mit Studierenden, deren Betreuenden sowie internationalen Partnerinnen und Partnern. Ein prägendes Erlebnis war für mich die Antwort eines Industriepartners auf meine Frage, welche Kompetenzen unseren Promovierenden beim Einstieg fehlen. Seine Antwort: „Alle – wir müssen sie sechs Monate lang neu einlernen.“ Das war für mich ein Weckruf. Daraufhin haben wir gemeinsam mit dem Unternehmen grundlegende Änderungen an unserem Ausbildungsansatz vorgenommen, zum Vorteil für die Studierenden, die Betreuenden und die zukünftigen Arbeitgeber.
Junge Forschende sind oft stark in der Theorie, aber es fehlt an praktischen und übertragbaren Kompetenzen. Die Ausbildungsprogramme, die ich leite, setzen genau hier an: Sie verbinden exzellente akademische Ausbildung mit praxisnaher, sektorübergreifender Erfahrung durch strukturierte Praktika und Co-Innovationen. Wir vermitteln gezielt Fähigkeiten in Projektmanagement, Kommunikation und internationaler Zusammenarbeit und bereiten die Studierenden durch die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten optimal auf die Zukunft vor.
Inwieweit stimmen universitäre Curricula mit praktischen Anforderungen überein – zum Beispiel in Bereichen wie Medizintechnik oder translationaler Forschung?
In vielen Institutionen besteht hier weiterhin eine Kluft. Oftmals erscheinen praxisrelevante Module erst als „Add-on“ in den letzten Studienjahren. Solche Änderungen umzusetzen ist nicht einfach: Als Leiter des Fachbereichs Physik an der University of Liverpool von 2016 bis 2023 haben wir unser Curriculum umfassend modernisiert – mit Python-Programmierung, hybrider Lehre und fächerübergreifenden Modulen im Grundstudium. Wir haben Module sowohl horizontal innerhalb eines Studienjahres als auch vertikal über mehrere Jahre hinweg vernetzt, um den Kompetenzaufbau gezielt zu fördern. Das stieß zunächst auf viel Widerstand. Projekte wie unsere Forschung zu mobiler, niedrig dosierter und kostengünstiger 3D-Röntgentechnologie mit dem Unternehmen Adaptix zeigen jedoch, wie angewandte Forschung gleichzeitig die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden fördern und medizinische Innovationen hervorbringen kann.
Welche Rolle spielen interdisziplinäre Ansätze und internationale Zusammenarbeit bei der Ausbildung des Wissenschaftsnachwuchses?
Für mich sind diese Aspekte absolut essenziell. Wissenschaftliche Herausforderungen – von der medizinischen Diagnostik bis zur Beschleunigerphysik – erfordern vielfältige Expertise. Durch die Zusammenarbeit von Physik, Informatik, Ingenieurwesen und Medizin entstehen Innovationen an den Schnittstellen. Kooperationen mit Einrichtungen wie CERN (Schweiz), GSI/FAIR (Deutschland) oder klinischen Zentren in ganz Europa sind dabei unverzichtbar für exzellente Forschung und den Transfer in die Anwendung.
Europa hat sich das Ziel gesetzt, ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen. Wie gut wird dieses Ziel derzeit erreicht?
Europa hat sich in der Tat viel vorgenommen und auch wichtige Schritte gesetzt, aber im Vergleich zu den USA hinkt es bei der Umsetzung von Grundlagenforschung in marktfähige Produkte noch hinterher. Asien – insbesondere China – holt rasant auf. Um Schritt zu halten, muss Europa Verwaltungsbarrieren abbauen, Fördermechanismen beschleunigen und Anreize für öffentlich-private Partnerschaften schaffen. In der Förderung der Wissensverwertung sind wir auf einem guten Weg, aber es bleibt noch viel zu tun.
Wie wirken sich aktuelle Entwicklungen in den USA auf die wissenschaftliche Landschaft dort und in Europa aus?
Die USA ziehen weiterhin Spitzenkräfte durch flexible Fördermöglichkeiten und eine ausgeprägte Start-up-Kultur an. Das erhöht den Druck auf Europa, seine Strukturen für Talentbindung und Förderungen zu verbessern. Gleichzeitig befördert das den Wettbewerb und inspiriert zu gemeinsamen Projekten. Besorgniserregend sind einige politische Tendenzen, die internationale Zusammenarbeit und Austausch einzuschränken drohen. Gerade in globalen Herausforderungen wie der Medizintechnologie ist internationale Zusammenarbeit jedoch unerlässlich.
Welche Rahmenbedingungen benötigen junge Talente, um ihre Ideen in die Realität umzusetzen?
Sie brauchen Zugang zu hochwertiger Infrastruktur, erfahrene Mentorinnen und Mentoren, flexible Fördermöglichkeiten und klare Regelungen zum geistigen Eigentum. Auch ein gewisses Maß an Jobsicherheit ist wichtig – befristete Verträge über viele Jahre hinweg wirken hier eher hinderlich. In unseren Ausbildungsprogrammen haben wir gezeigt, dass sich wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Denken erfolgreich kombinieren lässt. Anfangs waren viele Industriepartner skeptisch, ob Universitäten dies wirklich leisten können – unsere zahlreichen Erfolge sprechen inzwischen für sich. Erfolgreiche Kooperationsbeispiele haben sich als sehr wirksam erwiesen, um weitere Unternehmen für unsere Programme zu gewinnen.
Wie können politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sicherstellen, dass Europa nicht nur die Grundlagenforschung unterstützt, sondern auch Start-up-Kultur, Wissenstransfer und industrielle Umsetzung fördert?
Politik sollte gezielt Fördermittel für translationale Forschung bereitstellen, das „Valley of Death“ zwischen Forschung und Marktreife überwinden helfen, Spin-offs gezielt unterstützen und die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie aktiv fördern. Eine Vereinfachung von EU-Förderverfahren sowie forschungsgeleitete Regulierung – gerade im Bereich Medizintechnik – würden das Innovationsökosystem Europas deutlich stärken. Der Europäische Innovationsrat ist ein Schritt in die richtige Richtung.
In der Medizinprodukte-Branche beobachten wir zunehmende Regulierung. Behindert das die Innovation oder fördert es Vertrauen und Qualität?
Grundsätzlich ist Regulierung gut gemeint, aber übermäßige Anforderungen können insbesondere frühe Innovationsphasen behindern. Entscheidend ist für mich das richtige Maß: Regulierungen müssen das öffentliche Interesse schützen, dabei aber Spielräume für explorative Forschung lassen. Adaptive Regulierungsansätze, die im Dialog mit der Wissenschaft entstehen, sind essenziell – gerade in dynamischen Bereichen wie der KI-gestützten Diagnostik.
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie optimiert werden, um den Wissenstransfer zu stärken?
Gemeinsame Forschungsziele, Co-Betreuung von Promotionsprojekten und Forschungsaufenthalte in Unternehmen haben sich in unseren Programmen als besonders erfolgreich erwiesen. Unsere Arbeit bei LIV.INNO und im EuPRAXIA-Netzwerk zeigt, wie strukturierte Kooperationen Spitzentechnologien hervorbringen – von der medizinischen Bildgebung bis hin zu neuartigen Plasma-Beschleunigern. Wichtig ist auch, diese Erfolge sichtbar zu machen, damit andere ihnen folgen können.
Welche drei konkreten Maßnahmen wünschen Sie sich, um Bildung und Innovationskraft in Europa nachhaltig zu stärken?
- Verwaltungsbarrieren und Verzögerungen bei EU-Förderungen abbauen,
- Innovationsausbildung und sektorübergreifende Praxisphasen verpflichtend in fast allen Doktorandenprogrammen verankern,
- langfristige Konsortien aus Wissenschaft und Industrie fördern, um wissenschaftliche Durchbrüche in gesellschaftlichen Nutzen – besonders im Gesundheitsbereich – zu überführen.
Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die am Anfang ihrer Karriere stehen?
Bleibt neugierig und offen für interdisziplinäre Wege. Eine Karriere dauert heute oft 50 Jahre und wird viele Veränderungen beinhalten. Eine breite Kompetenzbasis ist dafür entscheidend – es ist ein Marathon, kein Sprint. Sucht euch Mentorinnen und Mentoren und Kooperationen außerhalb eures Fachgebiets. Und vergesst nicht: Eure Forschung sollte Wirkung zeigen – denkt frühzeitig darüber nach, welchen Beitrag sie für reale Herausforderungen leisten kann, etwa in Medizin, Klima oder Technologie.