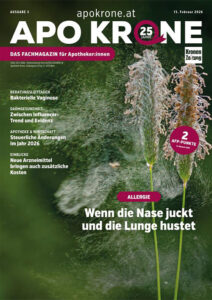„Nicht schönreden, sondern handeln“!
Kürzere Wartezeiten, der Ausbau digitaler Angebote und das Ziel, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen stehen auf der Agenda der Staatssekretärin und für Königsberger-Ludwig steht klar fest: Effizienz entsteht nicht durch Sanktionen, sondern durch Orientierung, Transparenz und Menschlichkeit.

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig im Gespräch mit Das Medizinprodukt.; Foto: Roland Ferrigato
Was sind für Sie die wichtigsten Stärken, auf denen das bestehende solidarische Gesundheitssystem derzeit aufbauen kann?
Die größte Stärke unseres Gesundheitssystems ist, dass es unsere Gesellschaft als Solidargemeinschaft begreift. Wir lassen niemanden zurück, weil Krankheit jeden treffen kann, unabhängig vom Kontostand. Dieses Prinzip macht uns als Gesellschaft aus: dass jede und jeder weiß, dass man Hilfe bekommt, wenn sie gebraucht wird. Genau diesen Ansatz will ich schützen und weiterentwickeln. Denn für mich steht fest, dass ein Gesundheitssystem nur dann stark ist, wenn es für alle da ist.
Das hat auch klare ökonomische Vorteile, denn wenn wir Risiken solidarisch tragen, wird es für alle günstiger. Wir profitieren von einer gesünderen Gesellschaft, von weniger Fehlzeiten, von mehr Lebensqualität. Und das medizinische Personal profitiert von sicheren Arbeitsplätzen und einer stabilen Struktur. Solidarität ist keine Belastung, sie ist eine Investition in unser aller Zukunft.
Sie betonen, dass das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem zurückgewonnen werden muss. Welche konkreten Maßnahmen planen Sie dazu?
Die Menschen erwarten keine Wunder, aber sie erwarten Ehrlichkeit und Fortschritt. Was sie nicht verstehen, ist Stillstand. Wenn sich die Systempartner nur streiten, aber keine Lösungen sichtbar werden, dann leidet das Vertrauen. Was die Menschen wollen, ist Transparenz über Probleme und das ehrliche Bekenntnis, sie zu lösen. Wir arbeiten daher intensiv an Verbesserungen: kürzere Wartezeiten, mehr wohnortnahe Versorgung, weniger Bürokratie. Wenn sichtbar wird, dass wir anpacken und Verantwortung übernehmen, dann kommt auch das Vertrauen zurück.
Ist die Patientenlenkung hilfreich, um Effizienzpotenziale zu heben?
Ja, unbedingt. Patientinnen und Patienten sollen genau dort versorgt werden, wo sie die beste Hilfe bekommen, sei in der niedergelassenen Allgemeinmedizin, bei Fachärztinnen und Fachärzten oder im Spital. Dafür braucht es Orientierung. Die Gesundheitshotline 1450 soll genau das leisten – sie soll zum zentralen Gesundheits-Navi werden, und zwar kostenlos, rund um die Uhr erreichbar und niederschwellig. Sie zeigt, wo es die passende Versorgung für das jeweilige individuelle Anliegen gibt.
Was wir nicht brauchen, sind Sanktionen. Gesundheit ist ein Grundbedürfnis. Zu glauben, dass man Menschen mit Schmerzen durch Gebühren vom Gang in die Ambulanz abhält, wenn sie sich nicht anders zu helfen wissen, ist naiv.
Welche konkreten Schritte sind vorgesehen, um eine zentrale Antrags- und Abwicklungsstelle für Heilbehelfe und Hilfsmittel umzusetzen?
Wir haben den One-Stop-Shop gerade im Nationalrat einstimmig beschlossen, das ist ein wichtiger Schritt. Jetzt geht es an die Umsetzung. Wir prüfen gemeinsam mit den Ländern und der Sozialversicherung, wo diese zentrale Anlaufstelle am besten verankert wird. Es gibt gute Modelle, auf denen wir aufbauen können. Ich bin seit gut 100 Tagen im Amt und wir haben das Thema sofort aufgegriffen. Jetzt braucht es etwas Geduld, aber wir bringen das auf den Boden.
Welche Digitalisierungsmaßnahmen müssen im Gesundheitswesen rasch umgesetzt werden und was braucht es dazu an konkreten Schritten?
Die Digitalisierung ist keine Zukunftsvision, sondern Realität. Wir müssen sie als Chance begreifen. ELGA ist dabei das digitale Rückgrat unseres Gesundheitssystems. Ab Juli 2025 müssen Labors und Radiologieinstitute ihre Befunde verpflichtend in ELGA einspielen, damit beenden wir endlich unnötige Doppelbefundungen. Ab 2026 wird ELGA übersichtlicher, mit digitalem Medikamentenplan und klaren Gesundheitsdaten-Zusammenfassungen. Auch das ELGA-Portal wird benutzerfreundlich und mobil optimiert, als Basis für eine eigene App. Das bringt mehr Sicherheit, mehr Effizienz und am Ende mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten.
„Die größten Hebel für eine verbesserte Gesundheitsversorgung liegen nicht nur in der Bewusstseinsbildung, der Verbesserung der Gesundheitskompetenz und dem Ausbau der Vorsorge, sondern vor allem auch in der Modernisierung und Effizienzsteigerung.“
Wie wird Telemedizin ausgebaut und welche Rolle haben Medizinprodukte dabei?
Telemedizin ist eine echte Chance, besonders für Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Problemen bietet sie große Vorteile: regelmäßige Überwachung, schnelle Reaktion bei Auffälligkeiten, weniger Spitalsaufenthalte und mehr Eigenständigkeit im Alltag. Auch für die Ärztinnen und Ärzte bedeutet das effizientere Abläufe durch Telekonsile, Telekonferenzen oder die bessere Vernetzung über ELGA. Gerade in der Verbindung mit digitalen Medizinprodukten entsteht ein modernes, flächendeckendes Versorgungssystem rund um die Uhr und patientenzentriert.
Bis wann wird es in Österreich die ersten digitalen Gesundheitsanwendungen erstattungsfähig geben und welche Pläne hat die Regierung dazu?
Digitale Gesundheitsanwendungen werden kommen und sie sollen allen zugutekommen, nicht nur wenigen. Bis 2027 ist ihre Integration in die Regelversorgung vorgesehen, wie im Bundes-Zielsteuerungsvertrag festgelegt. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits, auch zur Frage der Erstattungsfähigkeit. Klar ist: Es braucht hohe Qualitätsstandards, faire Zugänge und eine sinnvolle Einbindung in bestehende Strukturen wie ELGA. Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, sie muss die Versorgung verbessern und den Menschen im Mittelpunkt behalten.
In welcher Form sollen Gesundheitsdaten künftig stärker für Prävention und gesundheitspolitische Planung genutzt werden?
Bislang fehlen uns oft grundlegende Daten. Hier wurde in den vergangenen acht Jahren viel verschlafen. Wenn wir die Gesundheitsversorgung gezielt weiterentwickeln wollen, brauchen wir eine solide Datengrundlage. Ohne sie bleibt gute Planung ein Blindflug. Jetzt setzen wir erste Schritte: Ab 1. Jänner 2026 wird die verpflichtende Diagnosecodierung eingeführt, damit schließen wir eine zentrale Lücke, vor allem im niedergelassenen Bereich. Parallel machen wir bei ELGA rasch Fortschritte: mit klaren Zusammenfassungen der wichtigsten Gesundheitsdaten und einem digitalen Medikamentenplan sowie einem benutzerfreundlichen Portal, das auch mobil funktioniert. Klar ist: Wenn wir Ressourcen effizienter einsetzen wollen ohne Einbußen für die Patientinnen und Patienten, führt an einer besseren Datennutzung kein Weg vorbei.
Effizienz zu heben und Bürokratie abbauen zieht sich durch das Regierungsprogramm. Wo haben wir hier Potenziale in der Gesundheit?
Ein zentrales Instrument dafür ist ELGA. Wir bauen ELGA gerade zum digitalen Rückgrat unseres Gesundheitssystems aus – mit einem übersichtlichen Portal, klaren Zusammenfassungen der wichtigsten Gesundheitsdaten und einem digitalen Medikamentenplan. Damit schaffen wir endlich mehr Überblick, vermeiden Doppelbefundungen und geben medizinischem Personal mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten. Unser Ziel ist weniger Papierkram, mehr Zuwendung.
Wie realistisch ist die Schaffung eines bundesweit einheitlichen Gesamtvertrages samt erforderlicher rechtlicher Rahmenbedingungen und wie könnte ein Zeithorizont aussehen?
Ich bin pragmatisch optimistisch. Zu einem Gesamtvertrag haben sich alle Systempartner bekannt und ganz ehrlich: Ich komme aus Amstetten und niemand versteht, warum man auf der anderen Seite der Enns andere Leistungen bekommt als bei uns herüben. Aber sobald es ins Detail geht, merkt man schnell, dass dem einen oder anderen das Hemd dann doch näher als der Rock ist. Zusammengefasst bin ich optimistisch, aber ich will auch keine falschen Erwartungen wecken. Der Wille ist da, aber der Weg braucht noch gemeinsame Anstrengung.
Wenn Sie auf die geplante Weiterentwicklung des Gesundheitssystems blicken – wo stehen wir Ihrer Meinung nach in fünf Jahren?
Ich wünsche mir, dass wir in fünf Jahren sagen können: Wir haben unser solidarisches Gesundheitssystem gestärkt. Die Wartezeiten sind kürzer geworden. Die Versorgung ist besser planbar, für Patientinnen, Patienten und für das Personal. Vor allem aber will ich sagen können, dass die Menschen wieder Vertrauen spüren. Weil sie sehen, dass wir nicht alles schönreden, sondern anpacken. Und dass Gesundheit nicht bei der Krankheit beginnt, sondern mit Prävention. Dazu zählen etwa Impfungen – eines der wirkungsvollsten Präventionsinstrumente. Neben den bestehenden Programmen für Kinder und Jugendliche soll auch das Erwachsenen-Impfprogramm erweitert werden – etwa um Grippe oder FSME. Prävention bedeutet Gesundheit sichern, bevor Krankheit entsteht.