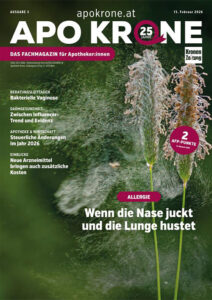Die Zeiten für Wissenschaft und Forschung sind schwieriger geworden – warum Österreich dennoch Hoffnung macht. Während in den USA Unsicherheit wächst, bietet Österreich Stabilität, eine freie Wissenschaftskultur und ein hochqualifiziertes Netzwerk aus Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen.
Österreich kann in den vergangenen Jahren beeindruckende Erfolge in der Forschung vorweisen: Zwei Jahre hintereinander gingen Nobelpreise für Physik an österreichische Forscher und heimische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler holen regelmäßig hochdotierte Grants des European Research Council (ERC) ins Land. Beim jährlichen Innovationsranking der EU hat sich Österreich inzwischen auf Platz sechs vorgearbeitet. Doch reicht das aus, um in der internationalen Forschungswelt als „Innovation Leader“ wahrgenommen zu werden?
„Strukturell ist die Lage der Wissenschaft in Österreich sehr erfolgreich und großteils stabil“, sagt Dr. Johannes Grillari, Direktor des Ludwig Boltzmann Instituts für Traumatologie. Dennoch nennt er bekannte Schwächen: „Wir haben eine Unterdotierung der Grundlagenforschung, eine überbordende Bürokratie und zu viele prekäre Arbeitsverhältnisse, gerade für Postdocs.“ Im Vergleich zur Schweiz zum Beispiel ist der Wissenschaftsfonds FWF mit nur einem Drittel des Budgets des Schweizerischen Nationalfonds ausgestattet. Diese knappe Finanzierung hemmt nicht nur Forschungsideen, sondern auch Karrieren: „Der Übergang vom Postdoc zur Gruppenleitung ist das Nadelöhr“, betont Grillari.
Erfolge trotz schwieriger Bedingungen
Österreichs Forschungslandschaft zeichnet sich dennoch durch internationale Wettbewerbsfähigkeit aus – vor allem in der translationalen Forschung, die Grundlagenwissen in Anwendungen übersetzt. Das hat nicht zuletzt mit einem „großartigen wissenschaftlichen Nachwuchs zu tun“, so Grillari. Die Erfolgsbeispiele sind zahlreich: Start-ups aus der universitären Forschung setzen innovative Diagnostikmethoden und Therapien um, die aus der Grundlagenforschung hervorgehen.
Eine neue Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), des Instituts für Höhere Studien (IHS) und Joanneum Research zeigt sogar: Jeder Euro, der in FWF-geförderte Forschung fließt, bringt kurzfristig 1,1 Euro an Staatseinnahmen zurück – durch Gehälter, Steuern und Folgeinvestitionen. Langfristig entstehen daraus Innovationen, Patente, Start-ups und letztendlich kommerzielle Produkte, die den Wirtschaftsstandort Österreich stärken. Beispiele sind Technologien zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten oder personalisierte Medizin.
Planungssicherheit und weniger Bürokratie
Gerade diese Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Aufstieg in die europäische Spitzenliga noch Arbeit erfordert und vor allem gegenüber den Anstrengungen in Asien noch unzureichend ist. Laut EU-Innovationsanzeiger ist Österreich auf einem guten Weg, gehört aber noch nicht zu den „Innovation Leaders“ wie Dänemark, Belgien oder die Niederlande. Ein wichtiger Faktor ist die Forschungsfinanzierung, und die kann sich in Österreich durchaus sehen lassen: Mit 3,3 Prozent des BIP (EU-Schnitt: 2,3 Prozent) liegt sie im EU-Raum auf Platz 3 hinter Belgien (3,43 Prozent) und Schweden (3,40 Prozent).
Dr. Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, formulierte dazu: „F&E-Ausgaben sind Zukunftsausgaben. Die Kuh, die wir morgen melken wollen, müssen wir heute gut füttern.“ Sein Appell: nicht nur das Niveau halten, sondern gezielt erhöhen – auch und gerade in Zeiten knapper Budgets.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen sich oft langfristig mit fehlender Planungssicherheit konfrontiert. Jobsicherheit ist, wenn überhaupt, oft nur für wenige Jahre gegeben, bis das geförderte Projekt ausläuft und ein neuer Antrag durchgeht – oder nicht. Um sich abzusichern, werden zahlreiche Förderanträge geschrieben – der Zeitaufwand ist immens. Gerade erfahrene Forschende verbringen sehr viel Zeit damit, Projektmittel einzuwerben. Zeit, die ihnen dabei fehlt, tatsächlich aktiv zu forschen. Viele kleine, kurzfristige Projekte erhöhen zudem den administrativen Aufwand, ohne ausreichend Freiraum für grundlegende wissenschaftliche Arbeit zu lassen.
Expertinnen und Experten fordern deshalb, die Laufzeiten von Förderprogrammen zu verlängern, Budgets zu bündeln und die Antragssysteme zu vereinfachen. Noch kritischer ist die Lage für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Junge Forschende, insbesondere Postdocs, arbeiten oft unter prekären Bedingungen: kurze Verträge, unsichere Perspektiven und fehlende Tenure-Track-Modelle treiben viele Talente aus der Wissenschaft in die Industrie oder gleich ins Ausland. Es entsteht ein Kreislauf, in dem immer wieder neue Kräfte angelernt werden müssen, die wiederum nach wenigen Jahren abwandern. Um diesen „Braindrain“ zu stoppen, braucht es nicht nur Geld, sondern vor allem strukturierte Karrierepfade, klare Aufstiegschancen und ausreichend unbefristete Stellen.
Während oft von einem „Förderdschungel“ in Österreich die Rede ist, sieht Grillari das differenzierter: „Die breite Förderlandschaft sehe ich durchaus positiv.” Er betont die schnellen Entscheidungsverfahren von FFG und Austria Wirtschaftsservice, und dass Österreich grundsätzlich ein attraktiver Standort sei, um High- oder Deep-Tech-Firmen zu gründen. Das eigentliche Problem sieht Grillari auf europäischer Ebene: Es fehle an ausreichend Risikokapital, insbesondere im Vergleich zu Regionen wie den USA oder Asien. „Damit sind schnelles Wachstum der Firmen und die schnelle Entwicklung der Produkte gefährdet – was wiederum das Überleben der Start-ups nach den ersten drei bis fünf Jahren erschwert.“ Hier wäre eine stärkere Unterstützung durch gezielte Risikofonds oder öffentlich-private Partnerschaften gefragt, um Innovationen über die erste Gründungsphase hinauszutragen.
USA-Krise als Chance für Österreich?
So gern wir in der Vergangenheit auch neidisch hinüber auf die USA geschaut haben – aktuell sind viele europäische Forschende froh, nicht über den Atlantik gewandert zu sein. Über Nacht eingefrorene Förderungen, Berichte über Ausweisungen von in den USA tätigen internationalen Forschenden und eine Zensur, die auch vor der Forschung nicht Halt macht – die neue Regierung unter Trump hält die Wissenschaftsszene in Atem. Angesichts der drastischen Einschnitte in der US-Forschungsförderung unter Präsident Trump wittert Österreich Chancen, Top-Forscherinnen und -Forscher anzulocken. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner, BSc, hat bereits ein Perspektivenpaket geschnürt: eine zentrale Onlineplattform mit Jobangeboten, 50 Stipendien für „students at risk“ sowie eine geplante Gesetzesänderung, die Unis erlaubt, bis zu zehn Prozent der Professuren im beschleunigten Verfahren („Opportunity-Hiring“) zu besetzen. Auch Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig betonte kürzlich, dass versucht wird, US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv nach Wien zu holen.
Dass wissenschaftliche Exzellenz oft weitere Talente anzieht, zeigt sich nirgendwo so deutlich wie in Wien. Die Stadt verbindet eine reiche Tradition in der medizinischen Forschung mit einer hochdynamischen Gegenwart: Rund 120 spezialisierte Biotechnologie-Unternehmen, viele mit Fokus auf Gesundheitsthemen wie Krebs, Immunologie und Infektionskrankheiten, sind hier aktiv. Auch 79 Medizinprodukte-Unternehmen mit Schwerpunkten in Software und In-vitro-Diagnostik haben sich in der Stadt etabliert.
Auf akademischer Seite führt Wien das Feld in Österreich an: Sechs Universitäten, zwei Fachhochschulen und elf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beschäftigen über 12.600 Menschen im Life-Sciences-Bereich. Mehr als 34.000 Studierende und knapp 9.000 wissenschaftliche Publikationen pro Jahr unterstreichen Wiens Position als herausragender Forschungsstandort. Die Kombination aus Forschung, Lehre, klinischer Expertise und internationaler Vernetzung macht Wien zu einem der attraktivsten Standorte Europas – und zu einem Anziehungspunkt für Spitzenforscherinnen und -forscher aus aller Welt.
Wissenschaft geht uns alle an
Wer Österreich als Forschungsstandort stärken will, muss in die Grundlagen investieren – und das bedeutet nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch langfristige Planungssicherheit. Förderprogramme brauchen längere Laufzeiten, Universitäten benötigen bessere Ausstattung, und exzellente Nachwuchsforschende müssen echte Karriereperspektiven haben. Nur so lassen sich Talente nicht nur gewinnen, sondern auch halten. Das gilt umso mehr in Zeiten globaler Veränderungen. Während in den USA die Unsicherheit wächst, bietet Österreich Stabilität, eine freie Wissenschaftskultur und ein hochqualifiziertes Netzwerk aus Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen. Diese Stärken gilt es auszubauen. Denn am Ende entscheidet nicht nur das Geld, sondern auch die Qualität des Umfelds. Dort, wo sich Forschende mit Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe austauschen können, wo Exzellenz gefördert wird und wo eine offene, kollaborative Kultur herrscht, entstehen die Innovationen, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft voranbringen.
„Laut Wissenschaftsbarometer 2023 sind 80 Prozent der österreichischen Bevölkerung der Meinung, dass der Staat Wissenschaft ausreichend finanzieren sollte. Besonders wichtig sei es daher, das Vertrauen der Menschen zu erhalten. Erfolgreiche Wissenschaftskommunikation kann hier viel bewirken. Formate wie die Lange Nacht der Forschung, die European Researchers’ Night oder Initiativen wie das LBG Open Innovation in Science Center gehen in einen aktiven Dialog mit der Bevölkerung und erhöhen das gegenseitige Verständnis“, sagt Grillari. Das LBI Trauma sieht er als Best-Practice-Beispiel, unter anderem dadurch, dass das Institut der engagierten Wissenschaftlerin Dr.in Conny Schneider Raum und Zeit für Wissenschaftskommunikation zur Verfügung stellt. Von Science-Events, Magazinartikeln bis hin zu täglichen Interaktionen auf Social Media gilt es, Fakten zu streuen, Wissen zu vermitteln, Vertrauen herzustellen, so breit und zugänglich wie möglich. Das geplante Science Communication Center in der Wiener Innenstadt ist für Grillari ein klares Zeichen, wie sehr Wissenschaftskommunikation in Österreich geschätzt wird.
Wenn es um die Frage geht, wo Österreich in zehn Jahren stehen soll, sind sich viele einig: als Land, das international sichtbar ist, jungen Forschenden eine Zukunft bietet, auf Exzellenz und Kooperation setzt. Österreich muss heute die Bedingungen schaffen, damit die Talente von morgen hier arbeiten und weitere Talente anziehen.