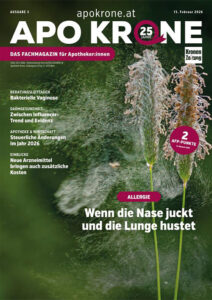Steht ein neues Wirtschaftswunder bevor?
In seiner Eröffnungsrede machte AUSTROMED-Präsident Gerald Gschlössl auf den hohen Stellenwert der Digitalisierung für die heimischen Medizinprodukte-Unternehmen aufmerksam. Eine von der AUSTROMED durchgeführte Umfrage zeigt, dass 56 von 61 befragten Unternehmen die Bedeutung von Medizinprodukten im Bereich der Digitalisierung sehr hoch bzw. hoch einschätzen. Herausforderungen sind dabei vor allem regulatorische Anforderungen, der Datenschutz, die Datensicherheit sowie die Erstattung digitaler Medizinprodukte. „Wir fordern daher die rasche Umsetzung der e-card auf dem Smartphone, die Umsetzung des E-Verordnungsscheins in der mySV-App und die Stärkung dieser App mit Integration aller Vertragspartnerinnen und -partner der Sozialversicherung“, brachte Gschlössl drei Forderungen der AUSTROMED auf den Punkt.

AUSTROMED-Frühjahrsgespräche im Zeichen der Innovation: Mag. Philipp Lindinger, DI Dr. Joachim Bogner, Karl-Heinz Land, Mag.a (FH) Ing.in Christine Stadler-Häbich, Gerald Gschlössl, Mag.a (FH) Lena Sattelberger, Peter Lehner (v. l. n. r.).; Foto: Sabine Klimpt – Lichtblick KG
Wie künstliche Intelligenz „alles“ verändert
Die Keynote des digitalen Darwinisten, Zukunftsdenkers und Bestsellerautors Karl-Heinz Land zeigte eindrucksvoll, dass es an der Zeit ist, den digitalen Wandel nicht nur zu meistern, sondern aktiv zu gestalten. Er beschreibt, mit welcher Dynamik digitale Technologien die Welt verändern und warum Unternehmen sich jetzt anpassen müssen, um zukunftsfähig zu bleiben. „Künstliche Intelligenz verändert wirklich alles und diese transformative Kraft birgt die Chance auf ein neues Wirtschaftswunder“, ist der Strategieberater überzeugt und beziffert das Wertschöpfungspotenzial für Deutschlands Wirtschaft mit 330 Milliarden Euro sowie 149 Milliarden Euro allein für die Verwaltung. Mit einem durchaus realistischen Blick auf mehr Bewusstsein bei Digitalisierungsprojekten schlägt er die Brücke zwischen zukunftsweisenden Innovationen durch künstliche Intelligenz und den realen Herausforderungen im unternehmerischen Alltag, denn: „Die digitale Welt und die echte Welt gehören untrennbar zusammen. Alles, was sich digitalisieren lässt, wurde und wird digitalisiert – damit kann es vernetzt und letzten Endes auch automatisiert werden.“
 |
 |
Der „Dampfmaschinenmoment“ der Digitalisierung
Er lädt ein zu einem Rückblick in das Jahr 1750, die Geburtsstunde der Dampfmaschine: „Das hat die sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen radikal verändert. Damals lebten 80 Prozent der Bevölkerung in bäuerlichen Strukturen auf dem Land. Mit Einzug der Maschinen entstanden Fabriken und die Urbanisierung startete. Menschen haben erstmals für ihre Arbeit Löhne bezogen, Gewerkschaften und Arbeiterparteien entstanden.“ Für Lang ist klar: „Die KI ist die Dampfmaschine der Neuzeit, denn sie übersetzt Energie sehr günstig in Arbeitsleistung. Deshalb wird auch die KI die sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen verändern. Wir werden gezwungen sein, uns anzupassen, ‚adapt or die‘ ist daher der Hebel, den wir akzeptieren müssen.“
 |
 |
Doch für Lang ist das kein Grund zur Sorge, denn die Entwicklungen der Vergangenheit zeigen auch, dass sich mit diesem Dampfmaschinenmoment das Bruttoinlandsprodukt aller Staaten massiv erhöht hat und der Wohlstand gestiegen ist, die Arbeitsbedingungen sich verbessert haben und die Arbeit nicht weniger wurde. Wichtig ist aus Sicht des Strategieexperten aber, dass die Energiepreise niedrig gehalten werden und in die technische Infrastruktur investiert wird. Seine Thesen lauten: „Der Produktivitätsschub durch KI wird, je nachdem, welche Anwendung wir betrachten, zwischen 25 und 90 Prozent liegen. Jedes Unternehmen und jede Organisation wird daher zeitnah eine eigene KI-Strategie entwickeln müssen, schon allein, um zu verhindern, dass Wissen im Unternehmen bleibt und nicht mit den Menschen in Pension geht.“ Nachdem auch KI nicht frei von Fehlern ist, gilt es, die Wissenslücken der Systeme zu schließen, daher plädiert Lang dafür, dass Unternehmen keine KI „von der Stange“ einsetzen, sondern speziell auf die Bedürfnisse und das Wording im eigenen Unternehmen hin trainieren – hin zu einer „kollaborativen Intelligenz“, um in großen Stil Routinearbeiten abzunehmen.
 |
 |
„Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir gehen nur nicht verantwortungsvoll mit der Arbeitskraft um“, ist Lang außerdem überzeugt und bringt als Beispiel die Arbeiten für Ausschreibungen: „Unterlagen zu sichten und zusammenzutragen war bisher eine mühevolle wochenlange Arbeit, das kann eine – abgestimmt auf Unternehmensbedürfnisse – trainierte KI jetzt in 20 Minuten schaffen. Die frei werdenden Kapazitäten der Fachkraft können für echten Kundenservice und zur Entwicklung innovativer Projekte eingesetzt werden“, sagt Lang.
Von der Hierarchie zu vernetztem Wissen
Damit die neue Welt und die alte Welt gut ineinander übergehen können, fordert Lang die Abkehr von einem hierarchischen Führen hin zu einem Arbeiten in Netzwerken mit eigenverantwortlichen Mitarbeitenden, die auf Basis gut strukturierter Informationen auch gute Entscheidungen treffen können. „Wir müssen überlastete Arbeitskräfte durch kollaborative Intelligenz unterstützen“, so Lang und rät Unternehmen dringend zum Aufbau sogenannter „Unternehmensontologien“, einer strukturierten, formalen Beschreibung von Begriffen, Konzepten und deren Beziehungen, die dazu dient, Wissen zu standardisieren, Informationen zu vernetzen und ein gemeinsames Verständnis zwischen Menschen, Systemen und Abteilungen zu schaffen.
 |
 |
„Diese Transparenz fördert Innovation, verbessert die Skalierbarkeit, schafft ein kontinuierliches Wissensmanagement und einen massiven Wettbewerbsvorteil, der sich auch noch in einer Kostenreduktion niederschlägt“, beschreibt der Experte die Vorteile. Auch für den Fall, dass ein Mitarbeitender das Unternehmen verlässt, hat Lang ein Tool entwickelt: „Eine KI führt dann ein Interview und dokumentiert etwaige Wissenslücken in der Ontologie.“
 |
 |
Abschließend plädiert Lang dafür, keine Angst vor der künstlichen Intelligenz zu haben, und lädt zu einem wohl überzeugenden Gedankenexperiment ein: „Stellen Sie sich vor, Ihr Mitbewerb wird mit einer Ontologie um nur 30 Prozent pro Jahr in seiner Performance besser – dort kann mit einem Drittel der Mannschaft dasselbe geleistet werden oder, anders gesagt, der Output bei gleichbleibendem Input um 30 Prozent erhöht werden.“
Mut zur Veränderung
Dass diese Entwicklung auch zu weitreichenden Veränderungen im Gesundheitswesen führen wird, liegt auf der Hand: Neue Rollen und Verantwortlichkeiten werden entstehen, aber ebenso die Frage, wie man eine gute Balance zwischen Effizienz, Produktivität und menschlicher Fürsorge erzielen kann, um diese Transformation erfolgreich im Sinne eines solidarischen Systems zu gestalten. „Dieser Einblick hat auf jeden Fall deutlich gezeigt, dass wir uns alle nicht einfach zurücklehnen dürfen, sondern aktiv die Umgebung gestalten müssen“, resümiert Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), für den die Keynote vor allem ein Appell ist, mutig an Neues heranzugehen. Bei allen Innovationen im Bereich der Medizinprodukte, die zu mehr Effizienz im System – schon jetzt – führen, bleibt für den SVS-Experten die zentrale Frage offen, wie es in Zukunft gelingen kann, Menschen zu motivieren, in der persönlichen Dienstleistung tätig zu sein. In der SVS wird aktuell zum Beispiel im Arzneimittelbewilligungsservice oder im Callcenter KI-unterstützt gearbeitet – Menschen bleiben aber die Letztentscheider.
 |
 |
In einer abschließenden Fishbowl-Diskussion brachten DI Pascal Mülner vom Cluster Human.Technology.Styria sowie die AUSTROMED-Vorstandsmitglieder Ing.in Mag.a (FH) Christine Stadler-Häbich und DI Dr. Joachim Bogner konkrete Fragen aus der Praxis auf das Podium und rundeten damit den Themenbogen der AUSTROMED-Frühjahrstagung ab.