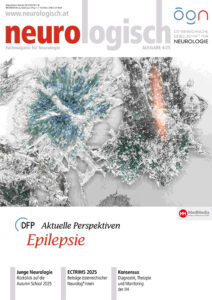Wie bleibt das Gesundheitssystem finanzierbar?
Die Gesundheitsausgaben steigen von 7,7 Prozent des BIP im Jahr 2023 auf 8,9 Prozent des BIP im Jahr 2040 bzw. 10,3 Prozent des BIP im Jahr 2070. Daher muss ein immer größerer Teil der Staatseinnahmen für die Finanzierung des Gesundheitssystems aufgewendet werden und das führt zu einem deutlichen Finanzierungsproblem. Auf der Suche nach passenden Lösungen hat sich nun auch der Fiskalrat eingeschaltet und Stakeholderinnen und Stakeholder an einen Tisch gebracht. Einblicke in Hintergründe und erste Schritte beschreibt Dr. Johannes Holler, Senior Economist im Büro des Fiskalrates.
Warum beschäftigt sich der Fiskalrat mit der Frage der Gesundheitsreform?
Der Fiskalrat beschäftigt sich mit allen Themen, die die öffentlichen Finanzen langfristig stark beeinflussen. Unsere Analysen im Nachhaltigkeitsbericht, in dem wir die Entwicklung der Staatsausgaben bis 2070 betrachten, zeigen, dass besonders im Bereich Gesundheit mit den größten Ausgabenzuwächsen zu rechnen ist. Die Gesundheitsausgaben werden voraussichtlich um rund 2,6 Prozentpunkte des BIP steigen. Deshalb ist die Frage, wie das Gesundheitssystem strukturell reformiert und effizienter gestaltet werden kann, für uns ein zentrales Thema.
Was treibt die Kostenkurve am stärksten an?
In unseren Analysen trennen wir sehr klar zwischen demografischen Effekten – also der Veränderung der Bevölkerungsstruktur auf Basis von Prognosen – und allen anderen Faktoren. Rund 40 Prozent des erwarteten Ausgabenanstiegs sind demografisch bedingt, etwa 60 Prozent gehen aber auf höhere Stückkosten zurück. Diese steigen aus mehreren Gründen: zum einen durch den medizinischen Fortschritt, denn neue Geräte, Medikamente und Therapien sind oft deutlich teurer; zum anderen durch die Lohnentwicklung im Gesundheitsbereich. In einer Volkswirtschaft steigen Löhne üblicherweise mit der Produktivität. Im Gesundheitswesen ist das Produktivitätswachstum jedoch nahezu null, weil es sich um einen sehr personalintensiven Bereich handelt. Für viele Behandlungen braucht man heute ähnlich viel Arbeitszeit wie vor 20 Jahren. Steigen die Löhne, ohne dass die Produktivität mitwächst, wird relativ gesehen ein immer größerer Teil der Wirtschaftsleistung für Gesundheit benötigt. Hinzu kommt die Einkommenselastizität der Nachfrage: Wenn es uns wirtschaftlich besser geht, „konsumieren“ wir mehr Gesundheit. Wir nutzen mehr Leistungen, was sich ebenfalls in den Stückkosten niederschlägt.
Welche Rolle spielen strukturelle Effekte im Versorgungssystem?
Die Zahl der Belagstage in den Spitälern ist zwar zurückgegangen, aber die Bettenkapazitäten und die Fixkostenstrukturen wurden nicht im gleichen Ausmaß angepasst. Die Personalkosten steigen zwar etwas moderater, doch weniger belegte Betten führen nicht automatisch zu sinkenden Spitalsausgaben. Für die Spitäler wird de facto weiterhin ähnlich viel Geld ausgegeben. Gleichzeitig wächst die Nachfrage im niedergelassenen Bereich stark, was zusätzlich Mittel bindet. In der aktuellen Umstellungsphase von stationär auf ambulant haben wir damit eine teure Doppelstruktur, denn das ambulante Angebot wird ausgebaut, ohne dass die stationären Kapazitäten konsequent zurückgenommen werden. Eigentlich bräuchte es eine Neuordnung der Spitalsstruktur inklusive Schließungen oder Umwidmungen von Standorten. Doch das ist politisch sehr schwierig zu kommunizieren. Zu oft wird nur über Kosteneinsparungen gesprochen und zu wenig über die Qualitätsgewinne und Versorgungsvorteile für die Bevölkerung. Wenn es gelingt, diese Veränderungen als Chance für bessere, wohnortnahe und patientenorientierte Versorgung zu vermitteln, lässt sich diese notwendige Strukturreform auch in der Bevölkerung positiver verankern.
Große Reformen im Gesundheitswesen gelten immer auch als politisches Risiko – entweder platzt eine Regierung daran oder sie wird bei der nächsten Wahl abgestraft. Genau hier sehe ich aber die Politik in der Verantwortung: Sie muss Reformen so erklären und kommunizieren, dass die Bevölkerung versteht, warum Veränderungen notwendig sind und welchen Nutzen sie bringen. Nur dann wird es möglich sein, strukturelle Reformen tatsächlich umzusetzen.
Welche anderen Staatsaufgaben werden leiden, wenn das Gesundheitswesen mehr Geld benötigt?
Wenn mehr Geld in die Gesundheit fließt, geht das immer zulasten anderer Staatsaufgaben, denn das Budget ist begrenzt und am Ende müssen die Politikerinnen und Politiker Prioritäten setzen. Es gibt dabei kein objektiv „richtig“ oder „falsch“, aber man sieht in der Praxis sehr deutlich, wo bisher eingespart wird. Der Staat hat viele Aufgaben und das Sozialsystem ist einer jener Bereiche, die besonders viele Ressourcen binden. Kürzungen bei Sozialleistungen stehen daher in direkter Konkurrenz zu steigenden Gesundheitsausgaben.
Gleichzeitig gibt es Ausgabenbereiche, die politisch kaum zur Disposition stehen, etwa klassische staatliche Kernaufgaben wie Landesverteidigung, Polizei und innere Sicherheit oder auch das Bildungssystem. Der real verfügbare Spielraum für Einsparungen ist daher relativ klein. Vor diesem Hintergrund ist langfristig auch eine Leistungseinschränkung im Gesundheitsbereich nicht völlig auszuschließen, zumal wir uns ein Gesundheitssystem leisten, das im europäischen Vergleich sehr kostenintensiv ist.
Wir müssen uns bewusst dem Thema stellen, dass das öffentliche System nicht mehr jede denkbare Leistung anbieten kann. Spitalsbetreiber weisen immer wieder darauf hin, dass sie viele Leistungen erbringen müssen, weil ein Rechtsanspruch darauf besteht. Genau hier ließe sich ansetzen und grundlegend fragen: Welche Leistungen müssen aus solidarischen Gründen garantiert werden und wo könnte man das Angebot einschränken, bündeln oder anders organisieren, ohne die Versorgungsqualität massiv zu gefährden? Diese Abwägung wird eine der zentralen politischen Fragen der kommenden Jahre sein.
Sie haben einen Workshop mit Bund, Ländern, Gemeinden, Sozialversicherung, Ärztekammer und Gesundheitsexpertinnen und -experten abgehalten. Diese Runde sitzt häufiger an einem Tisch, warum sollte sie jetzt andere Lösungen finden?
Diese Frage ist völlig berechtigt. Was wir in diesem Prozess aber sehr deutlich wahrnehmen, ist ein atmosphärischer Unterschied. In unseren Runden wird ausgesprochen sachorientiert diskutiert, weil es nicht um tagesaktuelle Budgetentscheidungen oder Zuständigkeiten geht. Wir befinden uns in einer Phase, in der man offen reden kann, ohne dass jedes Wort sofort als Verhandlungsposition gelesen wird.
Genau das ist die Idee hinter dem Prozess: Wir als Fiskalrat sind nicht in die operative Steuerung eingebunden und wollen den Partnern nichts „von oben“ verordnen. Wir schaffen einen Rahmen, in dem sie sich gewissermaßen ihre Reformen selbst erarbeiten können, und wir können als unabhängige Institution von außen Vorschläge machen. Man darf unsere Rolle nicht überschätzen, aber es scheint, als wäre etwas in Bewegung geraten. Seit wir gestartet sind, hat auch die „Reformpartnerschaft Gesundheit“ von Bund, Ländern und Gemeinden neuen Schwung bekommen. Unsere Hoffnung ist, dass ein objektiverer, evidenz- und expertenbasierter Zugang zur Gesundheitsreform möglich wird.
„Digital vor ambulant vor stationär“ – wie bringt man diese Logik von der Folie in die Fläche?
In Österreich haben wir keine verpflichtende Patientensteuerung. Diese vollständige Wahlfreiheit klingt sympathisch, führt aber eben auch dazu, dass kaum etwas gesteuert oder koordiniert abläuft. Dabei wäre es durchaus möglich, gewisse Verpflichtungen festzulegen: etwa, dass ich vor dem Gang in die Ambulanz verpflichtet bin, 1450 anzurufen oder ein digitales Triage-Angebot zu nutzen, natürlich mit Ausnahmen für echte Notfälle.
Parallel dazu muss aber das Angebot auf der untersten Versorgungsstufe stimmen: Wir brauchen einen massiven Ausbau der Primärversorgung, mehr Gruppenpraxen und Zentren mit erweiterten Öffnungszeiten, damit es auch nachts und am Wochenende erreichbare Alternativen zur Spitalsambulanz gibt. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre die versorgungswirksame Einbindung des Wahlarztsystems. Es spielt schon heute eine wichtige Rolle in der Versorgung, wird aber im Steuerungsdiskurs oft ausgeblendet. Wenn es gelingt, diese Ressourcen gezielt in eine abgestufte Versorgungskette einzubinden, kann „digital vor ambulant vor stationär“ tatsächlich zu einer spürbaren Entlastung für das System und zu mehr Orientierung für Patientinnen und Patienten beitragen.
Das Positive daran ist, dass es eine Reihe „low hanging fruits“ gäbe, doch wenn das System nicht einmal bereit ist, diese naheliegenden Schritte zu setzen, dann ist der Leidensdruck offenbar noch nicht groß genug.
Was wäre beim nächsten Workshop für Sie ein Erfolg?
Klar ist, dass ein echter Wandel im Gesundheitssystem nur über mehrere Jahre abzubilden ist. Ein Fortschritt wären erste Entwicklungen in zentralen Kennzahlen. Wichtige Indikatoren, die wir uns insbesondere mit Blick auf die Spitalsfinanzierung ansehen, sind etwa die Auslastung der Betten, die Zahl der Betten pro Einwohnerinnen und Einwohner im internationalen Vergleich sowie die Gesundheitsausgaben insgesamt und pro Kopf. All diese Größen sagen aber für sich genommen noch wenig aus. Wir müssen sie immer mit Qualitätsmerkmalen verknüpfen – etwa mit der selbst eingeschätzten Gesundheit der Bevölkerung („Wie fühle ich mich?“) oder mit Morbiditäts- und Mortalitätsdaten. Gerade hier schneiden wir derzeit im internationalen Vergleich nicht besonders gut ab. Wir haben extrem hohe Ausgaben bei vergleichsweise mitteläßigem Outcome. Dieses Wechselspiel muss man genau beobachten: es gilt, die Ausgaben zu senken und gleichzeitig die Qualität hochzuhalten oder idealerweise sogar noch zu steigern.
Welche Rolle nimmt der Fiskalrat jetzt als unabhängige Plattform ein, um das Thema weiterzuverfolgen, und welche nächsten Schritte sind geplant?
Der Fiskalrat versteht sich als unabhängige Plattform, die das Thema langfristig weiterverfolgt und immer wieder auf die Agenda bringt. Wir hatten kürzlich den zweiten Workshop, in dem wir bereits einen deutlichen Schritt weitergekommen sind – da ging es ganz konkret um die Spitalsreform. Das Problembewusstsein ist bei allen Beteiligten vorhanden, es gibt niemanden, der die Herausforderungen unterschätzen würde.
Bisher haben wir versucht, die „Taktzahl“ hochzuhalten und möglichst viele Akteure gleichzeitig in den Prozess einzubinden. Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir den Eindruck haben, dass die nächsten Schritte eher in bilateralen Gesprächen mit einzelnen Partnern sinnvoll sind.
Einen starren, detaillierten Fahrplan im Sinne eines Gesetzespakets gibt es zwar nicht, aber es gibt eine klare Prozesslogik mit weiteren Analysen, Gesprächen und Vorschlägen.