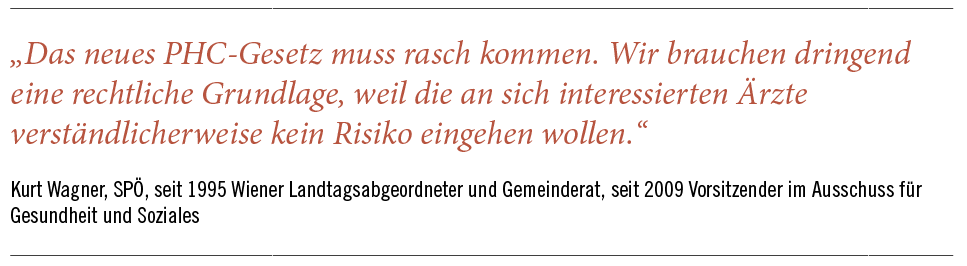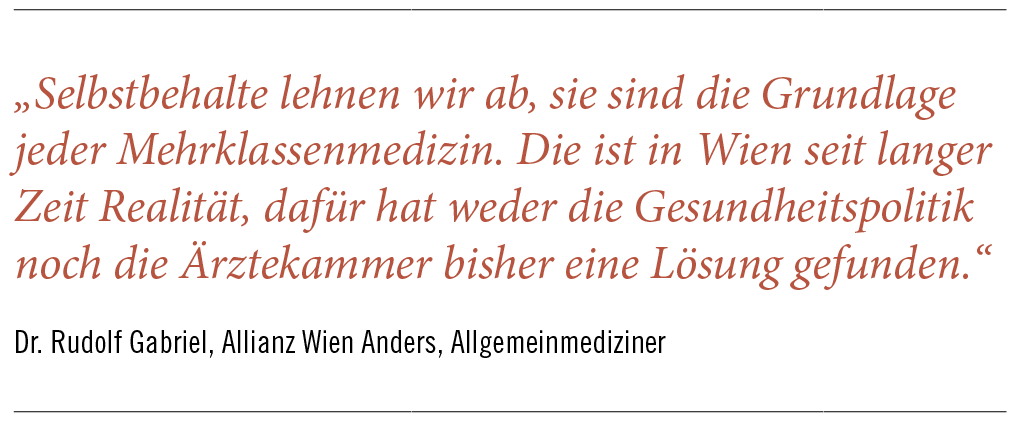Es ist kaum ein paar Monate her, dass die Wiener Gemeindepolitik ganz im Bann der Gesundheit stand: schier end- und ergebnislose Verhandlungen zwischen KAV und Spitalsärzten über neue Arbeitszeiten und bessere Gehälter, davon ausgelöste Weiße-Mäntel-Demonstrationen auf den Wiener Straßen, Gewerkschaftsgründungen, Protestkundgebungen im Messepalast, Fernsehdiskussionen und Klagsdrohungen des Hausärzteverbandes gegen die PHC-Pilotprojekte, Streikdrohungen der Spitalsärzte, Patientenkampagnen der Kammer usw. Und vielleicht ist es ja auch nur ein paar Monate hin, bis es wieder zu ähnlich öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzungen kommt und die Gesundheitspolitik wieder in den Mittelpunkt des Interesses rückt. Das Krankenhaus Wien-Nord könnte dafür eventuell ein prädestiniertes Thema sein. Wir werden sehen. Jetzt aber, mitten in der Hektik des Wiener Gemeinderatswahlkampfes hat die Kommunalpolitik ganz andere Prioritäten und Schauplätze für ihre parteipolitischen Auseinandersetzungen.
Trotzdem war es verwunderlich, dass selbst unter den Ärzten nur wenige die Gelegenheit nutzten, um sich über die Wahlprogramme, Konzepte und Ideen der Parteien zur zukünftigen Gestaltung der Gesundheitspolitik in Wien aus erster Hand zu informieren. Chancen dazu gab es jedenfalls zuhauf. Die Ärztekammer für Wien hatte nicht nur die fünf Spitzenkandidaten von SPÖ, Grünen, FPÖ, ÖVP und NEOS an fünf einzelnen Abenden zum „Ärztekammer-Check“ geladen, sondern ließ auch die Gesundheitssprecher der sechs aussichtsreichsten Parteien in einem „Politik-Talk“ direkt aufeinandertreffen: Kurt Wagner, SPÖ; Dr. Jennifer Kickert, Die Grünen; David Lasar, FPÖ; Dr. Michael Gorlitzer, ÖVP; Dr. Anna Kreil, NEOS, und Dr. Rudolf Gabriel, Wien Anders.
An besagtem Abend herrschte am Podium also deutlich größeres Gedränge als im Publikum, da blieben zwei Drittel der Plätze leer, kaum 25 Mitglieder hatten sich auf Einladung des Referats für Sozialpolitik in den Festsaal „verirrt“. Eine Diskrepanz, die besonders auffiel: Das Thema Jungmediziner und ihre Ausbildung bildete zwar einen thematischen Schwerpunkt der Veranstaltung, in der Altersverteilung des Publikums spiegelte sich das aber keinesfalls wider.
Ein reines Kommunikationsproblem?
Im ersten Themenkomplex ging es um die Versorgungssituation in der Stadt und die Bewertung des Verhandlungsergebnisses zu Arbeitszeiten und Gehältern der Spitalsärzte. SPÖ und Grüne verteidigten naturgemäß das Verhandlungsergebnis, räumten aber zumindest „Schwächen in der Kommunikation des Verhandlungsergebnisses“ ein, wie es Kurt Wagner ausdrückte. Wichtig sei aber letztendlich, „was dabei herausgekommen ist, nämlich kürzere Arbeitszeiten und ein höherer Grundgehalt, also das, was die Ärzte jahrelang gefordert haben.“ Die Versorgungssicherheit sei damit jedenfalls in keiner Weise gefährdet, ist sich Wagner sicher.
Die Opposition sieht in den Kommunikationsdefiziten hingegen noch das geringste Übel in der Angelegenheit. Michael Gorlitzer etwa vermisste eine angemessene Gesprächskultur gegenüber den Ärzten während der gesamten Verhandlungen: „Mir ist es wichtig, wertschätzend mit meinen Verhandlungspartnern umzugehen, das war bei den KAV-Verhandlungen leider nicht der Fall.“ Die Gehaltsanpassung sei zwar absolut notwendig gewesen, ebenso wie die neue Arbeitszeitregelung, dennoch sei dadurch die Versorgungssicherheit in den KAV-Spitälern gefährdet, erläuterte Gorlitzer. Eine Entwicklung, die sich noch verstärken werde, weil „die Jungärzte weiter abwandern, nicht nur wegen des vergleichsweise geringen Gehalts, sondern vor allem wegen der Ausbildungssituation in Wien. Diese ist schlechter als irgendwo sonst in Österreich.“
NEOS-Gesundheitssprecherin Anna Kreil kritisierte wiederum „die mangelnde Einbindung“ der Ärzte in die Verhandlungen. Eine Gehaltserhöhung um 30 Prozent sei zwar großartig angekündigt worden, „ist aber nie passiert“, sagte die Mitbegründerin der Ärztegewerkschaft Asklepios. Die Leistungsverdichtung aufgrund der Dienstzeitreform müsse unweigerlich zu einem Leistungsabbau und damit zu einem Qualitätsverlust führen, ist Kreil überzeugt: „Dafür will aber niemand die politische Verantwortung übernehmen.“
Prinzipiell gut, aber …
Der zweite Fragenkomplex drehte sich rund um die Themen Primärversorgung, Hausärzte, PHC-Gesetz. Ein klares Nein zum PHC-Konzept der Bundesregierung im Allgemeinen und den PHC-Pilotprojekten in Wien kommt von der Wiener FPÖ. „Wir lehnen PHC ab“, sagte David Lasar und kündigte schon einmal Widerstand seiner Partei gegen eine entsprechende gesetzliche Regelung an: „Die Ärzte wollen das offensichtlich nicht – und wir auch nicht. Ich werde daher gegen das PHC-Gesetz stimmen.“
Auch die ÖVP zeigt sich der PHC-Idee gegenüber skeptisch. „Bei PHC teilen wir die Angst der Ärztekammer, dass hier private, profitorganisierte Unternehmen einsteigen könnten, die den Ärzten dann Renditen vorgeben“, führte Gorlitzer aus. Sowohl ÖVP als auch FPÖ würden anstelle der PHC-Zentren, die die Kassenstellen noch weiter ausdünnen, „lieber die Position der Hausärzte stärken und sie adäquat für ihre Leistungen entlohnen“, wie es Lasar ausdrückte. „Wir verlangen zudem, dass Ärzte auch Ärzte anstellen dürfen.“ Damit ließen sich auch im bestehenden System längere Öffnungszeiten besser umsetzen, vermutete der FPÖ-Gesundheitssprecher.
Ein klares Bekenntnis pro PHC gab hingegen Kurt Wagner ab: „Wir brauchen eine gut funktionierende Primärversorgung, weil sie stark versorgungswirksam ist. Wir wollen den Zugang für Patienten verbessern, daher ein klares Ja zu PHC als wohnortnahe Versorgung mit längeren Öffnungszeiten und einem verstärkten Angebot für Langzeittherapien, Gesundheitsförderung und Prävention durch eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen Ärzten und anderen Gesundheitsgruppen.“
Auch Grüne, NEOS und Wien Anders halten PHC „prinzipiell für einen positiven Ansatz, um Ambulanzen zu entlasten“, wie Jennifer Kickert von den Grünen erklärte. Vor allem die Übernahme einer effizienten Lotsenfunktion wäre ein Mehrwert, den solche Versorgungszentren leisten könnten. Das hätten Beispiele in Dänemark oder den Niederlanden eindeutig gezeigt. Diese Lotsenfunktion „könnten natürlich auch die Hausärzte übernehmen, aber das passiert in der Praxis offensichtlich nicht“. Rudolf Gabriel von der Wahlplattform Wien Anders wiederum sieht in den multiprofessionellen PHC-Zentren ein Modell im Sinne der sich verändernden Anforderungen und Wünsche sowohl vonseiten der Patienten als auch der Ärzte: „Wir wissen, dass viele Jungärzte dem Modell positiv gegenüberstehen. Sie wollen nicht als Einzelkämpfer arbeiten, sondern im Team. Auch die Patienten sind an Interdisziplinarität und längeren Öffnungszeiten interessiert.“ Nicht einverstanden sei man allerdings mit den derzeit formulierten Mindeststandards solcher PHC-Zentren. „Zumindest die Sozialarbeit muss ein verpflichtender Bestandteil des Konzepts werden“, verlangte Gabriel.
In den Pilotprojekten gelte es jetzt einmal, Erfahrungen zu sammeln, was funktioniert und was nicht, sagte Anna Kreil, die jetzt einmal die Praxiserfahrungen aus den Projekten abwarten möchte, bevor ein PHC-Gesetz verabschiedet wird. „Natürlich muss man die gesetzliche Grundlage dafür schaffen, aber nicht unbedingt jetzt. Wichtiger wäre es, zuerst noch mehr Pilotprojekte zu machen und dann zu evaluieren, bevor man großartige Gesetze beschließt.“
In einem einzigen Punkt sind sich dann alle sechs Gesundheitssprecher aber doch noch einig: „PHC-Zentren gehören ausschließlich in die Verantwortung des öffentlichen Bereichs“, sagte Wagner stellvertretend für alle. Und Gabriel ergänzte: „PPP-Modelle (Anm.: Public Private Partnership) lehnen wir grundsätzlich ab, weil wir der Meinung sind, dass sie im Gesundheitssystem nichts verloren haben.“ Vielmehr sollte überlegt werden, assistierte Kreil, ob nicht auch „die Strukturen im öffentlichen Bereich angesiedelt werden sollten, etwa die medizinischen Geräte, das gäbe Jungärzten beim Start mehr finanzielle Sicherheit“.
… weniger ist manchmal mehr
Abschließend ging es dann noch um die Frage der Finanzierung des Systems. Während Wagner „Bewährtes“ nicht ändern will, sprachen sich alle anderen für eine Finanzierung aus einer Hand aus, wobei es letztendlich nicht so entscheidend wäre, ob diese Finanzierung aus den Steuern oder der Sozialversicherung kommen würde. Angeregt wurde außerdem eine Verringerung der Krankenkassen auf „zwei bis maximal drei“ (Lasar) „oder auch auf eine, wie das Dänemark vorgemacht hat“ (Gorlitzer).