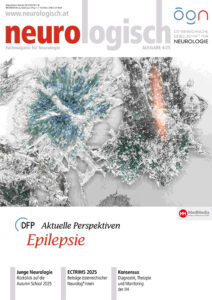Diagnosenkodierung wird verschoben
 © Armmy Picca - stock.adobe.com
© Armmy Picca - stock.adobe.com Im Gesundheitsausschuss des Nationalrates wurden am Dienstag weitreichende Entscheidungen in die Wege geleitet – unter anderem in Sachen Digitalisierung und Gesundheitsvorsorge.
Im Zuge der Arbeiten zur Implementierung der bundesweit einheitlichen Diagnosencodierung hätten sich einige Fragen hinsichtlich der technischen Umsetzung sowie der rechtlichen Grundlagen ergeben, sagten die Regierungsparteien am Dienstag im Gesundheitsausschuss des Nationalrates. Deshalb wird der Start verschoben, es kommt zuerst ein Pilotversuch. Im Zuge der im Jahr 2023 eingeleiteten Gesundheitsreform haben sich Länder und Sozialversicherung auf die Einführung einer verpflichtenden und bundesweit einheitlichen Diagnosencodierung verständigt. Durch die Zuordnung von Diagnosen und medizinischen Leistungen auf einheitliche Schlüssel (ICD-10-Codes) soll nicht nur die Behandlungssicherheit erhöht, sondern auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Gesundheitsdienstleistern erleichtert werden, wird in den Erläuterungen hervorgehoben.
Eine von der Regierung vorgeschlagene Novellierung des Bundesgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen (DokuG-Novelle 2025) sieht nun vor, dass nach dem stationären nun auch der gesamte ambulante Bereich eingebunden werden soll. Da ein im Laufe der Sitzung eingebrachter Abänderungsantrag einen Pilotbetrieb von sechs Monaten vorsieht, werden alle niedergelassene Ärzt:innen, Gruppenpraxen sowie Ambulatorien nun ab dem dritten Quartal 2026 (Meldung bis 30. November 2026) dazu verpflichtet, eine codierte Diagnosen- und Leistungsdokumentation durchzuführen und die Daten an die jeweiligen Krankenversicherungsträger zu übermitteln. Eine freiwillige Meldung sei jedoch bereits ab 1. Jänner 2026 möglich und soll für die Pilotierung genutzt werden.
Leistungserbringer:innen haben nur dann Daten an die Sozialversicherung zu übermitteln haben, wenn für sie auch gemäß Ärztegesetz eine Pflicht zur Nutzung der E-Card-Infrastruktur besteht. Wahlärzt:innen mit insgesamt weniger als 300 verschiedenen Patient:innen pro Jahr sind damit ausgenommen. Eine Klarstellung sei notwendig gewesen, da sonst das Gesetz in seiner ursprünglichen Form in Kraft getreten wäre, stellte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) fest. Österreich sei zudem eines der letzten Länder, das die einheitliche Diagnosencodierung umsetze.
Die ursprünglich für Anfang 2026 geplante Ablöse des „gelben Papierheftes“ durch den elektronischen Eltern-Kind-Pass verzögert sich und wird auf den 1. Oktober 2026 verschoben. Grundsätzlich soll der Eltern-Kind-Pass (EKP), der bis Ende 2023 als Mutter-Kind-Pass bezeichnet wurde, die Früherkennung von gesundheitlichen und psychosozialen Risikofaktoren von Müttern und deren Kindern ermöglichen. Bei der digitalen Variante des EKP stehe wiederum das Ziel im Vordergrund, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesundheitsdiensteanbietern und auch die Zuweisung zu diversen Unterstützungsangeboten (z. B. Frühe Hilfen) zu erleichtern. Die nun von der Regierung vorgelegte Novelle sieht nun im Konkreten vor, dass erst ab dem 1. Oktober 2026 alle neu festgestellten Schwangerschaften ausschließlich in elektronischer Form dokumentiert werden – und nicht wie geplant ab 1.1.2026. Außerdem sollen erstmals ab 1. März 2027 die Daten zu den Kindern, die ab diesem Tag geboren werden, elektronisch gespeichert werden. Durch den Beschluss im Gesundheitsausschuss werde nur die technische Umsetzung des EKP in die Wege geleitet, erläuterte Königsberger-Ludwig, der genaue Umfang, die Art und der Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchungen und der Hebammenberatungen sollen mittels Verordnung festgelegt werden. (rüm)