Experten diskutieren, wie man sich auf Krisen vorbereiten kann
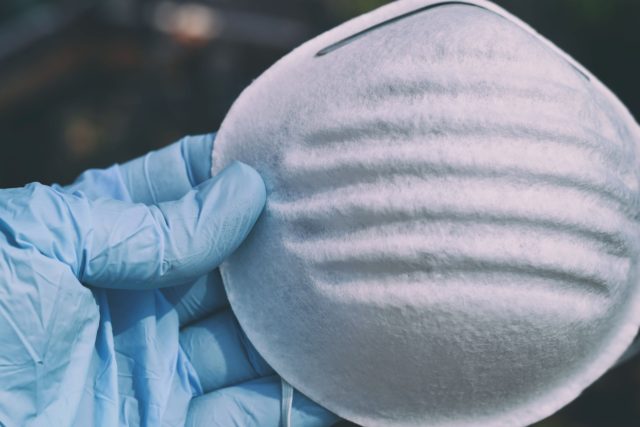 (c) Alexas_Fotos/Pixabay
(c) Alexas_Fotos/Pixabay „Bei der Corona-Pandemie fuhren wir in Zeitlupe gegen die Wand“, sagt Leopold Schmertzing. Der österreichische Analyst des wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments zeigt am Freitag beim Forum Alpbach Strategien auf, wie Staaten resilienter werden können.
Große Krisen lassen sich zwar prinzipiell vorhersehen, nur nicht wann sie eintreten und wie genau. Grundsätzlich kann man Krisen in eine Vorbereitungs- und eine Reaktionsphase unterteilen, erklärt Leopold Schmertzing, der am Freitag im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach einen Vortrag zum Thema „Wie man sich auf Krisen vorbereitet? Techniken der strategischen Vorausplanung“ hält. „In der Vorbereitungsphase auf die Pandemie ist einiges schief gegangen, gerade für Österreich und einige andere europäische Länder“, sagt der Experte im Gespräch mit der APA. „Ich bin überrascht von der fehlenden Vorbereitung, weil das nicht schwer vorherzusehen war. Das ist ein Bereich, wo wir sehr viele Daten haben, und wo wir wissen, es gibt viele unterschiedlichen Viren mit verschiedenen Charakteristiken, Ansteckungsraten und Inkubationszeiten.“ Angesichts vieler guter Experten auf diesem Gebiet sei das schmerzhaft – „da scheint etwas in der Verbindung zwischen Expertise und Politik nicht geklappt zu haben“. Die Reaktionszeit der österreichischen Bundesregierung, als sich das Virus drohte stark auszubreiten, sei hingegen sehr gut gewesen, betont Schmertzing.
Gerade bei häufig wiederkehrenden Krisen wie Waldbränden habe man in den vergangenen Jahren gesehen, wie rasch Länder beim Zivil- und Katastrophenschutz an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Das wiederum könne dazu führen, dass Staaten ihre Ressourcen für sich behalten und anderen nicht mehr aushelfen wollen oder können. In der Coronakrise zeigte sich das beispielsweise in dem weltweiten Gerangel um Schutzkleidung und -masken. Im Rahmen des nächsten EU-Budgets und dem Corona-Aufbauplan will die EU-Kommission daher ihre Kapazitäten für das Krisenmanagement aufstocken und mehr Unabhängigkeit erlangen. Zählte man bisher auf die Solidarität der EU-Länder und freiwillige Hilfsangebote, sollen nun strategische Reserven angelegt werden, die im Falle von Katastrophen aller Art rasch mobilisiert werden können.
Optimierungsbedarf sieht Schmertzing aber vor allem auf der strategischen Seite – etwa bedürfe es noch einer zentralen Krisenkoordinationsinstanz, die vorausschauend plant und auf wissenschaftliche Expertise setzt. Szenarien und Prognosen zu entwerfen sei aber beileibe keine einheitliche Wissenschaft, schon weil es keine empirischen Daten über die Zukunft gibt. Eine Hochrechnung bekannter Daten im Vorfeld müsse immer mit der Frage „Was ist, wenn…?“ kombiniert und Teil eines kreativen Prozesses sein. „Es muss Experten-, aber auch Gruppenmeinungen geben und systematisches Nachdenken. Die Extrapolation von Daten kann schon etwas bringen, aber das muss wirklich in einen Kontext gesetzt werden.“ Vor diesem Hintergrund bräuchte eine staatliche Krisenvorsorge sowohl eine quantitative Untersuchung über die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen von Desastern, als auch das Nachdenken über neue Probleme und außergewöhnliche Ereignisse. Der Staat solle dafür ebenso finanzielles wie auch geistiges Kapital investieren und dabei durchaus auch auf die Schwarmintelligenz seiner Bürger oder seiner Beamtenschaft setzen. Entscheidend sei die Steuerung und systematische Planung, sagt Schmertzing: „All das sollte durch ein Kompetenzzentrum geleitet werden, das behördlich aufgestellt ist, aber eng mit der Wissenschaft und anderen Teilen des Staats und der Gesellschaft arbeitet. Dieses soll modular aufgebaut sein und im Krisenfall leicht zu vergrößern sein.“ (APA)




















































































