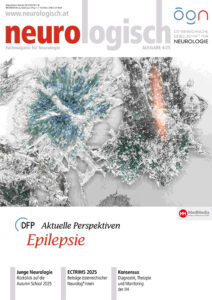Fachgesellschaften legen Reformideen vor
 © Pcess609 -stock.adobe.com
© Pcess609 -stock.adobe.com Die Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM) und die Österreichische Gesellschaft für Innere Medizin (ÖGIM) tun sich zusammen und wollen Patient:innen gemeinsam steuern.
Fehlende Kassenstellen, Bürokratie, lange Wartezeiten, überlastete Ambulanzen und Mehrklassenmedizin prägen zunehmend den Versorgungsalltag im Gesundheitswesen. Gleichzeitig verlieren sich Patient:innen in einem fragmentierten System aus Kassenmedizin, Wahlärzt:innen und Spitälern. Vertreter:innen der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM) und der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin (ÖGIM) haben sich nun zusammengetan und gemeinsame Konzepte entwickelt, mit denen Patientenirrwege verkürzt, Ressourcen geschont und die Versorgungsqualität verbessert werden sollen. Im Mittelpunkt steht eine stärkere, strukturierte Primärversorgung mit klar definierten Behandlungspfaden und einer zentralen Lotsenfunktion.
„Die Freiheit der Arztwahl ist faktisch eine Drei-Klassen-Medizin: Kassenmedizin, Zusatzversicherung – und man kennt jemanden“, formulierte Alexander Rosenkranz, Nephrologe an der MedUni Graz und Präsident der ÖGIM, vor Fachjournalist:innen. Was als Freiheit gelte, führe in der Praxis oft zu Selbstzuweisungen, Doppeluntersuchungen und ineffizienter Nutzung hochspezialisierter Strukturen. Ein zentrales Argument der Allgemeinmediziner:innen ist die Bedeutung der kontinuierlichen Arzt-Patienten-Beziehung. „Kontinuität und Koordination ersparen Leid, Geld und Folgekosten. Patient:innen leben länger, sind weniger krank, Prävention wirkt besser“, betonte ÖGAM-Vizepräsidentin Stephanie Poggenburg. Der strukturierte Einstieg über die Allgemeinmedizin reduziere nicht nur unnötige Spitalskontakte, sondern senke auch die Gesamtkosten des Systems.
Gerade bei unspezifischen Symptomen zeigt sich der Mehrwert dieses Ansatzes. Brustschmerzen etwa können ihren Ursprung in unterschiedlichen Fachgebieten haben – von der Kardiologie über die Gastroenterologie bis zur Orthopädie oder Psychosomatik. „Die Ersteinschätzung erfolgt am besten über Allgemeinmedizin:innen, die ihre Patient:innen kennen“, erklärte ÖGAM-Generalsekretär Anton Wankhammer. Nach Ausschluss einer akuten lebensbedrohlichen Situation könne die weitere Abklärung rasch, zielgerichtet und koordiniert erfolgen.
Demgegenüber steht die Realität einer zunehmend unpersönlichen Steuerung. Der telefonische Gesundheitsdienst 1450 wird von der Politik als Instrument zur Patientenlenkung forciert. Aus Sicht der Fachgesellschaften greift dieses Modell jedoch zu kurz. „Dort findet primär eine Dringlichkeitsbeurteilung statt“, sagt ÖGAM-Vizepräsidentin Susanne Rabady. Ohne Kenntnis der individuellen Vorgeschichte führe das berechtigte Sicherheitsdenken häufig zu Überreaktionen – mit unnötigen Spitalszuweisungen als Folge. Besonders kritisch sehen die Expert:innen die weit verbreitete Selbstzuweisung zu Fachärzt:innen. „Jeder Mensch beim Kardiologen ist ein kardiologischer Patient“, brachte es Rabady auf den Punkt. Fachärzt:innen klären verständlicherweise innerhalb ihres Spezialgebiets ab – unabhängig davon, ob dort die Ursache des Problems liegt. Patient:innen suchten dabei oft „den Ort ihrer größten Angst“ auf. Das Ergebnis sei Überdiagnostik, fehlende Gesamtschau und steigende Kosten.
Die Zersplitterung der Zuständigkeiten gilt auch im internationalen Vergleich als Achillesferse des österreichischen Systems. Studien zeigen, dass Informationsverluste zwischen Versorgungssektoren, parallele Diagnostik und mangelnde Rückkopplung an den Hausarzt die Versorgungsqualität beeinträchtigen und die Patientensicherheit gefährden. Einen konkreten Gegenentwurf präsentierten ÖGAM und ÖGIM mit gemeinsam entwickelten Behandlungspfaden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium wurde ein erster Pfad für Patient:innen mit Nierenerkrankungen erarbeitet – von der Hausarztpraxis über niedergelassene Internist:innen bis hin zu spezialisierten nephrologischen Ambulanzen. Weitere Pfade, etwa in der Kardiologie oder Rheumatologie, sollen folgen. „Mit den bestehenden internistischen Zusatzfächern könnten wir auf rund hundert Behandlungspfade kommen“, so Rosenkranz.
Diese Pfade definieren klar, welche Leistungen auf welcher Versorgungsebene sinnvoll erbracht werden können – und wann eine Überweisung notwendig ist. Ziel ist es, hochspezialisierte Strukturen vor Überlastung zu schützen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Betreuung sicherzustellen. Als Vorbild wird das hausarztzentrierte Modell aus Baden-Württemberg genannt. Dort können sich Patient:innen freiwillig bei einem Hausarzt oder einer Hausärztin einschreiben, die als erste Anlaufstelle fungieren und den Zugang zu Fachärzt:innen koordinieren. Studien zeigen: Patient:innen in diesem System sind gesünder, leben länger, entlasten das System und verursachen geringere Kosten. Auch Fachärzt:innen profitieren durch gezielte Zuweisungen, Spitäler durch Entlastung. Ein ähnlicher Ansatz wird mittlerweile für ganz Deutschland diskutiert.
Österreich hingegen setzt bislang stark auf Primärversorgungseinheiten (PVE). Diese könnten zwar ein wichtiger Baustein sein, warnt Poggenburg, dürften aber nicht zur anonymen „Ambulanzstruktur“ verkommen. „Ohne kontinuierliche Arzt-Patienten-Beziehung besteht die Gefahr der Ambulanzbildung – das widerspricht dem Kern der Primärversorgung.“ Die Analyse der Fachgesellschaften ist klar: Eine koordinierte, kontinuierliche Primärversorgung mit Hausärzt:innen als zentralem Anker ist kein nostalgisches Konzept, sondern eine evidenzbasierte Notwendigkeit. Die medizinischen Konzepte liegen auf dem Tisch, die Pilotprojekte sind vorhanden. Nun ist die Politik gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. (rüm)