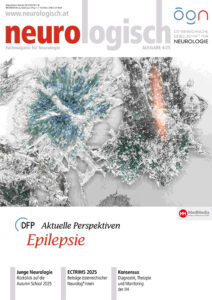Mythos: Wettbewerb und private Unternehmen sind besser
 © spotmatikphoto – stock.adobe.com
© spotmatikphoto – stock.adobe.com Die RELATUS-Redaktion entlarvt in der Serie „Mythen & Fakten“ die gängigsten Scheinargumente im Gesundheitswesen und liefert fundierte Antworten für Diskussionen.
Die öffentliche Hand wirtschafte im Gesundheitsbereich oft ineffizient, was zu hohen Kosten führe, ist oft zu hören. Mehr Wettbewerb würde dem System zudem gut tun – etwa im Bereich der Versicherungen. Doch hält das einer Prüfung stand? Das Effizienzpotenzial in jeder Organisation und jedem Unternehmen liegt bei etwa 5 bis 10 Prozent, lernt man zu Beginn eines Betriebswirtschaftsstudiums. Und es gehört auch zu den Aufgaben eines guten Managements, diese Potenziale zu nutzen und ein System besser zu machen. Nicht zuletzt deshalb halten auch private Managementmethoden Einzug im öffentlichen Bereich. Der Unternehmensberater Roland Berger Strategy Consultants rechnete vor einigen Jahren anhand deutscher Beispiele bei einer Präsentation in Wien vor, dass die Kosten für das Pflegepersonal – immerhin etwa 25 Prozent der gesamten Spitalskosten – um 10 Prozent gesenkt werden können, wenn Dienstpläne besser gesteuert werden und das Personal flexibler eingesetzt wird. Für die meisten Spitalsmanager:innen bedeutet dies vorerst einmal Ausgliederungen, Optimierungen und Druck auf Arbeitszeiten, Überstunden und Löhne.
Unter dem wirtschaftlichen Druck wurden in den vergangenen 20 Jahren auch in Deutschland viele öffentliche Krankenhäuser an private Klinikgruppen verkauft. Die größten davon sind die Schweizer Ameos (60 Standorte, 18.000 Beschäftigte), die auch in Österreich aktiv ist, Asklepios (34.000 Beschäftigte v. a. in Hamburg), die Helios-Kliniken (87 Kliniken, 126.000 Beschäftigte) des börsennotierten Fresenius-Konzerns, zu dem auch die Österreichische Vamed bis zum Sommer 2024 gehörte, die börsennotierte und mehrheitlich zu Asklepios gehörende Rhön Klinikum AG (14.000) und die Sana Kliniken AG (51 Standorte, ca. 35.000 Beschäftigte). Nicht wenige davon standen und stehen zunehmend unter Kritik: Gewerkschaften kritisieren Lohndumping, Hygienemängel und den Fokus auf höhere Honorare bringende Behandlungen. Das Personal sei demoralisiert und frustriert.
Bereits 2016 warnte die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie vor einer Ökonomisierung in der Medizin.1 Sie würde zunehmend das Arzt-Patienten-Verhältnis beschädigen. Wenn Krankenhausstrukturen vor allem darauf ausgelegt seien, größtmögliche Erlöse zu erzielen, führe das häufig zu einem Vertrauens- und Informationsverlust. „Es ist bereits üblich, Patienten am Tag des Eingriffs direkt nüchtern in den OP-Saal kommen zu lassen. Die Aufnahme auf die Station erfolgt dann erst nach dem Eingriff.“ Damit die Rechnung aufgeht, halten sich viele Krankenhausbetreiber an eine einfache Regel: möglichst viele Fälle, möglichst wenig Personal. Der Druck auf die Beschäftigten führt wiederum dazu, dass immer mehr Menschen ihre Jobs im Gesundheitswesen aufgeben.
Auch im niedergelassenen Bereich gibt es zunehmend private Anbieter. „Während Private-Equity-Firmen in der Vergangenheit vor allem an besonders profitablen Gesundheitsbereichen wie der Augenheilkunde, Labor-, Zahnarzt-, Radiologie- und Strahlentherapiepraxen interessiert waren, geraten in den letzten Jahren offenbar auch die Orthopädie, Kardiologie und sogar allgemeinmedizinische Praxen in den Fokus der Geldgebenden“, bilanzierte 2023 eine deutsche Studie.2 Eine der Folgen: Wettbewerbsbehörden sorgen sich, dass unter dem Radar monopolartige Strukturen entstehen. „Wir sehen in den vergangenen Jahren zunehmend Übernahmen und Beteiligungen von Finanzinvestoren an Arztpraxen, medizinischen Versorgungszentren und Kliniken. Leider können wir aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nur einen geringen Teil dieser Vorgänge kartellrechtlich kontrollieren. Der Fusionskontrolle unterliegt ein Erwerb nur, wenn das Zielunternehmen einen Mindestumsatz von 17,5 Millionen Euro erzielt hat. Es besteht die Gefahr, dass hier unter dem Radar des Bundeskartellamtes vermachtete Strukturen entstehen können“, warnte 2022 der Präsident des deutschen Bundeskartellamtes Andreas Mundt.3
Internationale Studien belegen, dass Privatisierungen ein System nicht billiger und auch nicht besser machen. Im Hinblick auf eine private Eigentümerschaft von Gesundheitseinrichtungen durch Privat-Equity-Fonds zeigt eine US-Studie im Sommer 2023 im British Medical Journal publiziert wurde, eindeutige Ergebnisse. Die Studienautor:innen hatten insgesamt 1.778 Studien gesichtet, von denen 55 die Einschlusskriterien erfüllten. Die Studien erstreckten sich über acht Länder und untersuchten Pflegeheime, Krankenhäuser und niedergelassene Ordinationen. Über alle Ergebnismessungen hinweg war Privat-Equity-Besitz durchgängig mit Kostensteigerungen für Patient:innen oder Kostenträger verbunden. Darüber hinaus war Privat-Equity-Besitz mit gemischten bis schädlichen Auswirkungen auf die Qualität verbunden.4
Ähnliche Ergebnisse lieferte auch eine Studie, die Ende 2023 im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlich worden ist. Die Autor:innen untersuchten Änderungen bei im Krankenhaus erworbenen unerwünschten Ereignissen und Krankenhausaufenthaltsergebnissen im Zusammenhang mit Private-Equity-Übernahmen von US-Krankenhäusern. Dazu wurden 662.095 Krankenhausaufenthalte in 51 durch Private Equity erworbenen Krankenhäusern mit Daten für 4.160.720 Krankenhausaufenthalte in 259 entsprechenden öffentlichen Krankenhäusern zwischen 2009 und 2019 verglichen. Dabei wurden im Krankenhaus erworbene unerwünschte Ereignisse oder Erkrankungen, wie Stürze, Infektionen mit Spitalskeimen, Behandlungsfehler und ungeplante Nachbehandlungen, bei 10.091 Krankenhausaufenthalten beobachtet. Nach der Private-Equity-Übernahme kam es bei öffentlich Versicherten (Medicare) zu einem Anstieg der im Spital erworbenen Erkrankungen um 25,4 Prozent im Vergleich zu denen, die in öffentlichen Kontrollkrankenhäusern behandelt wurden. Im Detail stieg die Zahl von Stürzen um 27,3 Prozent, Blutbahninfektionen in Verbindung mit zentralvenösen Kathetern legten um 37,7 Prozent zu – obwohl 16,2 Prozent weniger zentralvenöse Katheter gelegt worden waren. Die Zahl von Wundinfektionen verdoppelte sich in Private-Equity-Krankenhäusern, obwohl das Operationsvolumen um 8,1 Prozent gesunken war. In Kontrollkrankenhäusern gingen derartige Infektionen unterdessen zurück.5
In Deutschland wurden 2023 die Auswirkungen von Privat-Equity-Gesellschaften auf niedergelassene Arztpraxen untersucht, die von diesen Gesellschaften übernommen worden waren. Ein Gutachten des Forschungs- und Beratungsinstituts für Infrastruktur- und Gesundheitsfragen (IGES) Berlin zeigte bei Private-Equity-Gesellschaften ein im Vergleich zu Einzelpraxen um 8,3 Prozent erhöhtes Honoraraufkommen. Solche Ergebnisse könnten darauf hindeuten, dass ökonomische Motive im Vergleich zu Einzelpraxen eine größere Rolle spielen, analysierten die Autor:innen und warnten: Es bestehe die Gefahr, dass in den renditeorientierten Niederlassungen bevorzugt lukrative Behandlungen angeboten werden, während andere Versorgungsaufgaben, welche nicht zur geforderten Rendite beitragen, leiden beziehungsweise von anderen Leistungsträgern erbracht werden müssen.6
Zudem leide die freie Wahl der ärztlichen Behandlung. „Wenn in einer Stadt die Mehrheit der Praxen zu einer Private-Equity-Firma gehören, können sich die Menschen eventuell keine Zweitmeinung mehr einholen, ob eine Operation aus medizinischer Sicht auch wirklich notwendig ist.“7 Eine weitere Gefahr gehe vom Private-Equity-Geschäftsmodell aus: Die Arztpraxen-Konzerne würden operativ häufig fragil aufgestellt – mit sehr hoher Fremdverschuldung und nur geringen oder negativen Gewinnen. Dieses Modell diene der Steuerminimierung. Die Konsequenz für das Unternehmen ist ein hochrisikoreiches Modell, das schnell zum Konkurs führen könnte, sollte sich das wirtschaftliche Umfeld ändern. Passiert das, habe dies enorme Auswirkungen auf die Versorgung, die dann nicht mehr gewährleistet werden könne.
Dass diese Sorge nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigte 2023 ein Beispiel in der Schweiz, als der Konkurs der Mobile Ärzte AG vor allem im Kanton Aargau die Gesundheitsversorgung ins Schlingern brachte.8 Öffentliche Einrichtungen und andere Ärzt:innen, die allesamt selbst am Limit waren, mussten einspringen. 2024 rutschte die Hausarztkette „Allcare“ in Zürich in Konkurs und musste zusperren. In Österreich wiederum traf die Pleite von Rene Benko und der „Signa“-Gruppe ebenfalls Ordinationszentren in Tirol, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg.9 In Deutschland und der Schweiz, wo wiederum viele Spitäler privat geführt werden, ist auch die stationäre Versorgung unter Druck. Der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnete 2024 mit „Hunderten“ Spitälern, die verschwinden werden.
Auch der Wettbewerb unter Krankenversicherungen in Deutschland und der Schweiz produziert enorme Verluste. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat im Herbst Zahlen zur Entwicklung in Deutschland geliefert. Es zeigt sich eine Kostenspirale großen Ausmaßes. Die Defizite der Kassen werden sich demnach im Jahr 2030 auf 89 bis 98 Milliarden Euro belaufen – 2023 lag das Defizit noch bei rund 25 Milliarden Euro. Was deshalb in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder diskutiert wurde, waren Kürzungen der Leistungen der Krankenkassen. Der CDU-Wirtschaftsrat hatte zuletzt ganz offensiv eine Streichliste für Leistungen veröffentlicht. Zudem steigen die Beiträge. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gilt ein allgemeiner Beitragssatz, der 2025 bei 14,6 Prozent liegt. Er wird jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Obendrauf wird ein Zusatzbeitrag erhoben. Der lag 2025 bei 2,5 Prozent, im kommenden Jahr dürfte er auf 2,9 Prozent steigen. In der Schweiz sind die Beiträge in der Krankenversicherung im Jahr 2025 um durchschnittlich 4,2 Prozent gestiegen. Laut dem schweizerischen Bundesamt für Statistik dämpfte die Prämiensteigerung das Wachstum des verfügbaren Durchschnittseinkommens der Menschen im Jahr 2025 um 0,3 Prozentpunkte. Wären die Prämien zwischen 2024 und 2025 konstant geblieben, hätten die Haushalte mehr für Konsum oder Sparen zur Verfügung gehabt. In der Schweiz wie in Deutschland gilt keine Pflichtversicherung wie in Österreich sondern eine Versicherungspflicht, bei der man sich die Kasse selbst aussuchen kann. Kann man die Prämien aufgrund niedriger Einkommen nicht berappen, gibt es in der Schweiz Zuschüsse der öffentlichen Hand. Die Zahl der Menschen, die solche Zuschüsse erhalten, steigt stetig. (rüm)
- https://www.esanum.de/today/arzteschaft/chirurgen-wehren-sich-gegen-medizin-fliesband
- https://www.finanzwende-recherche.de/wp-content/uploads/Profite-vor-Patientenwohl_Private-Equity-Beteiligungen-an-Arztpraxen-in-Deutschland.pdf
- https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2022/29_06_2022_Augenarztpraxen.html
- https://www.bmj.com/content/382/bmj-2023-075244
- https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2813379
- Li et al.: Profite vor Patientenwohl: Private-Equity-Beteiligungen an Arztpraxen in Deutschland (2023) in https://www.awmf.org/service/awmf-aktuell/default-621339d7bddc2836aa3ee72e8e84d4e7-14
- ebenda
- https://www.medinside.ch/de/mobile-arzte-aargauer-taskforce-sucht-notloesungen-20231119
- https://www.medmedia.at/relatus-med/benko-signa-skandal-trifft-jetzt-aerztezentren/