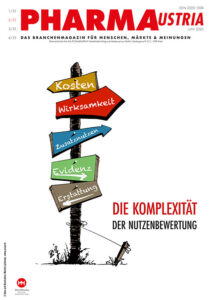„Überversorgung abstellen hilft gegen Unterversorgung“
 © Oliver Miller-Aichholz
© Oliver Miller-Aichholz ÖGK-Obmann Peter McDonald skizziert im RELATUS-Interview die Pläne zur Sanierung der Gesundheitskasse und erklärt, woher das Megadefizit wirklich kommt.
Die ÖGK macht derzeit Schlagzeilen mit Defizitzahlen und Spardebatten. Was ist da genau los? Ich habe vor drei Monaten den Vorsitz in der ÖGK übernommen mit einem prognostizierten Defizit von 900 Millionen Euro. Die Investitionen in Gesundheit haben sich in vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Wir haben allein seit der Fusion 3,5 Milliarden mehr investiert – das ist eine sehr gute Nachricht, weil es eine Investition in Gesundheit ist. Wir haben aber einige von uns nicht beeinflussbare Faktoren, die uns langfristig unter Druck setzen: Die geburtenstarken Jahrgänge kommen ins Pensionsalter und verlassen den Arbeitsmarkt. Seit den 1980er Jahren ist die Lebenserwartung um 10 Jahre gestiegen. In diesem Zeitraum hat sich die Zahl der Über65-Jährigen auf 1,9 Millionen Menschen fast verdoppelt. Diese Altersgruppe weist mit durchschnittlich 17,6 Kontakten je Patientin beziehungsweise Patient eine doppelt so Inanspruchnahme bei Allgemeinmedizinern verglichen zu den Unter65-Jährigen auf. Dazu kommt der medizinische Fortschritt, auf den wir sehr stolz sind, der aber seinen Preis hat. So verursachen etwa 0,8 Prozent aller Medikament-Verordnungen bereits mehr 40 Prozent der Gesamtkosten in dem Bereich. Etwas verkürzt formuliert: heute bedeutet eine Krebsdiagnose, dass die Erkrankung zu 80 Prozent heilbar ist, früher war es zu 80 Prozent ein Todesurteil. Das ist gut für den Einzelnen, für uns aber eine Herausforderung. Nicht selten kosten innovative Medikamente 6000 bis 8000 Euro pro Packung, sind aber für die einzelne entscheidend. Dazu kommt, dass immer mehr aus dem Spital in den Finanzierungsbereich der ÖGK ausgelagert wird. Trotz dieser Verlagerung beteiligt sich die ÖGK aber unverändert mit 6 Milliarden Euro pro Jahr an den Spitalskosten der Länder. Und: Angesichts der schlechten Wirtschaftslage mit mehreren Rezessionsjahren und hoher Arbeitslosigkeit haben wir auch einnahmenseitig ein Problem. All diese Faktoren sind für uns unbeeinflussbar und wir müssen uns drauf einstellen – auch künftig.
Sie sind nicht neu in der Sozialversicherung – sie waren schon 2011 bis 2014 stellvertretender Vorsitzender der Trägerkonferenz der österreichischen Sozialversicherungsträger. Waren die Entwicklungen nicht schon damals erkennbar, oder sind Maßnahmen unterblieben? Die demographischen Entwicklungen und der medizinische Fortschritt wurden weitgehend so prognostiziert. Es wurden Rücklagen und Investitionen getätigt. Der von manchen erhoffte Weiße Ritter, der Berge an Geld bringt, kam aber natürlich nicht. Wir müssen mit dem, was wir haben, auskommen und danach trachten, die künftigen Herausforderungen zu schaffen und gleichzeitig das Gesundheitswesen weiterentwickeln.
Welche Rezepte sind geplant? Meine Agenda ist es, dass wir die Spitzenmedizin auf e-Card auch für die künftige Generation erhalten. Wir können stolz darauf sein was Sozialversicherung und Ärzteschaft in den vergangenen Jahrzehnten für die Menschen geleistet haben. Dafür möchte ich mich auch ausdrücklich bedanken. Mit unserem Konsolidierungsplan machen wir eigentlich unsere Hausaufgaben, um dieses Zukunftsziel zu erreichen und wir setzen zugleich wichtige Bereinigungen von Überversorgungen und Fehlanreizen um. Diese machen die internen Strukturen schlanker, Leistungen treffsicherer und schaffen die Basis für einen fairen Leistungsbeitrag. Unsere Aufgabe ist es den Bedarf besser abzudecken, aber nicht jedes Bedürfnis. Das kann einen Beitrag leisten, dass die ÖGK in eine finanzierbare Zukunft steuert. Da auch für uns die Schwerkraft gilt, gilt auch das, was für den ordentlichen Kaufmann gilt: Wir können nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen.
Das ist nicht neu: das sind die gesetzlichen Vorgaben für die Krankenkassen – einnahmenorientierte Ausgabenpolitik. Ja, das stimmt, darum wundert es mich auch immer wieder, wenn das manche überrascht.
Wie sehen die geplanten Schritte genau aus? Wir fahren ein zweigleisiges Stufenmodell: Sofortmaßnahmen im ersten Schritt, um das Schiff wieder in die richtige Richtung zu lenken und nachhaltige Maßnahmen, um die Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln – was Vorsorge, Verfügbarkeit und Innovationen wie Telemedizin betrifft. Wir haben ein Maßnahmenbündel gesetzt, das bis 2026 eine schwarze Null bringen soll und mittelfristig helfen muss, Schulden abzubauen und etwas für Investitionen freizumachen. Wir wollen heuer das Defizit auf 250 Millionen reduzieren – das ist sehr ambitioniert, aber nicht unmöglich.
Wie soll das genau gelingen angesichts der von Ihnen skizzierten Grundprobleme? Ich habe in der Privatwirtschaft gelernt, dass man Unternehmen mit ambitionierten Zielen führt. Zuerst sparen wir bei uns, auch wenn wir schon jetzt nur zwei Prozent Verwaltungskosten haben. Wir besetzen jede zweite Pensionierung nicht nach, reduzieren Sachkosten und zehn Prozent der Flächen. Hätte die ÖGK so weitergemacht wie die Gebietskrankenkassen zuvor, hätte sie heute 900 Stellen mehr. Stattdessen haben wir seit der Fusion vor fünf Jahren 200 Stellen abgebaut. Macht zusammen 1100 Jobs weniger. Dazu kommt es zu mehr Beitragsgerechtigkeit durch die Anpassung des Krankenversicherungsbeitrages der Pensionistinnen und Pensionisten. Die Höhe legt das Parlament im Rahmen der Budgetbegleitgesetze fest. Und dann geht es darum einen besseren Ausgleich zu finden, was Über- und Unterversorgung betrifft. Wir sehen das selbst und immer wieder machen uns auch Expertinnen und Experten darauf aufmerksam, dass es beides parallel gibt.
Das wird nicht einfach – wie soll das gehen? Wir müssen differenzieren zwischen medizinisch notwendigen Leistungen und nicht notwendigen Leistungen. Wir wollen das Geld effizienter ausgeben – und bauen hier auch auf das Wissen und die Expertise der Ärzteschaft, mit denen wir eine vertrauensvolle Partnerschaft haben wollen. Die Botschaft ist: „Wenn ihr uns helft, die Überversorgung abzustellen, können wir die Unterversorgung leichter beseitigen.“ Wir wollen ja keine medizinisch notwendigen Leistungen streichen, sondern medizinisch nicht notwendige. Dazu hoffen wir auch auf eine stärkere Orientierung an der Wissenschaft bei den Verordnungen. Für die Überversorgung im Bereich CT/MRT entwickeln wir eine elektronisches Bewilligungssystem bis Ende des Jahres. Strukturell sollten wir auch Fähigkeiten anderer Berufsgruppen besser nutzen. Wir merken aber etwa auch, dass es medizinisch nicht induzierte Krankentransporte gibt. Das wollen wir sozial gestaffelt einbremsen. (Das Interview führt Martin Rümmele)