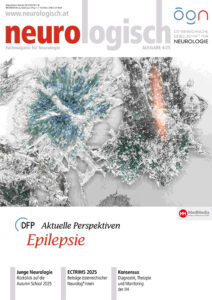Gesundheitsreformen im Nationalrat
 © Parlamentskorrespondenz
© Parlamentskorrespondenz Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS haben am Donnerstagabend ein umfangreiches Gesundheitspaket beschlossen. Die Opposition reagierte mit Kritik.
Der Nationalrat hat am Donnerstagabend den neuen Gesundheitsfonds für die Krankenversicherungen beschlossen. Dieser ist für die Jahre 2026 bis 2030 mit jeweils rund 500 Millionen Euro dotiert. Die Mittel sollen dem Ausbau der Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich dienen und für die Neueröffnung von Primärversorgungszentren sowie die Prävention eingesetzt werden. Genau genommen handelt es sich um drei Fonds, die bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sowie bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) eingerichtet werden sollen. Knapp 73 Prozent der Mittel erhält der Fonds der ÖGK, gut 22 Prozent der Fonds der SVS und der Rest geht an den Fonds der BVAEB, wobei ein Teil der Mittel erst nach Erreichen bestimmter Zielvorgaben überwiesen werden soll.
Dass die Gelder in neu aufgebauten Gremien verteilt werden, bewerteten FPÖ und Grüne mit scharfer Kritik. „Völlig sinnlos“ nannte etwa FP-Mandatarin Dagmar Belakowitsch den Fonds. Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner kritisierte, dass die Sozialversicherungen am Ende das Geld auch bekämen, egal ob sie Reformen machen oder nicht. Das Geld stammt aus der Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge der Pensionist:innen – eine Maßnahme, die am Donnerstag wieder von der FPÖ kritisiert wurde. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) verwies darauf, dass es dringend Geld etwa für den Ausbau der Primärversorgungseinrichtungen brauche. Jeder Bezirk werde eine PVE mehr haben, zudem werde etwas für die psychische Gesundheit der Österreicher getan, betonte VP-Klubobmann August Wöginger. Seitens der NEOS wurde hervorgehoben, dass das Geld nicht einfach in der Sozialversicherung versickern werde, sondern die Politik ein Mitspracherecht habe.
Ferner beschlossen wurde am Abend (ohne die Stimmen der FPÖ), dass alle neu festgestellten Schwangerschaften ab dem 1. Oktober 2026 nur noch digital dokumentiert werden. Der elektronische Eltern-Kind-Pass löst damit das gelbe Papierheft ab. Eigentlich hätte das schon Anfang 2026 passieren sollen. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach von einem wichtigen Schritt ins 21. Jahrhundert. Die FPÖ-Abgeordnete Belakowitsch monierte den „Zwang“ zur Digitalisierung ebenso wie die Umbenennung von Mutter- in Eltern-Kind-Pass. Das seit 2014 unveränderte Untersuchungsprogramm, das laut Regierungsvorlage jährlich rund 425.000 Kinder sowie 82.000 Schwangere und Neugeborene erfasst, soll weiterentwickelt und unter anderem durch eine zusätzliche Hebammenberatung vor der Geburt ergänzt werden, durch einen zusätzlichen Ultraschall gegen Ende der Schwangerschaft, weitere Laborleistungen sowie durch ein Gesundheitsgespräch, wie der Vorlage zu entnehmen ist. Bei Letzterem soll der Schwerpunkt auf der Erhebung von psychosozialen und sozioökonomischen Belastungen liegen. Der genaue Umfang, die Art und der Zeitpunkt der Untersuchungen und Gespräche sollen aber erst mittels Verordnung festgelegt werden.
Einstimmig vereinbart wurde, dass die Speicherfrist von ELGA-Gesundheitsdaten von zehn auf 30 Jahre ausgedehnt wird. Verspätet umgesetzt wird die einheitliche Diagnosecodierung – nämlich ab dem dritten Quartal 2026. Zunächst war ein Start mit Jahresanfang geplant, doch soll nun ein sechs Monate langer Pilotbetrieb beginnen, in dem Meldungen freiwillig möglich sind. Ausgenommen sind Wahlärzt:innen, die weniger als 300 Patient:innen im Jahr behandeln. Letzteres war einer der Gründe, warum die Grünen nicht zustimmten. Die Freiheitlichen brachten datenschutzrechtliche Bedenken vor und verweigerten ebenfalls die Zustimmung. Ebenfalls kein Ja der Opposition fand eine weitere Initiative, die von 2027 bis 2029 ein Preisband für wirkstoffgleiche Arzneispezialitäten festgesetzt. (red/APA)