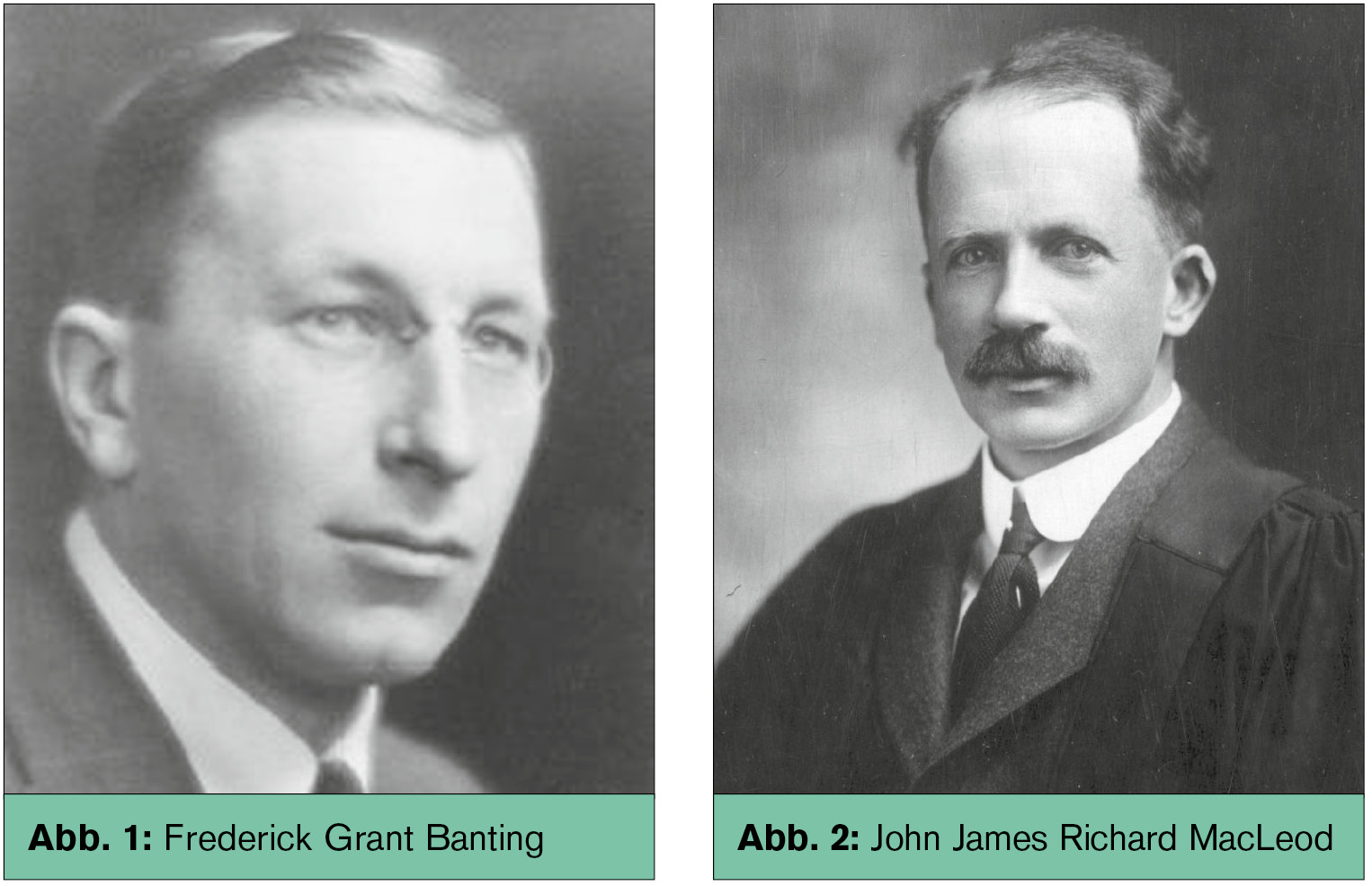Geschichte der Insulintherapie – Vom ersten Insulin zu modernen Insulinanaloga
Insulin ist ein lebenswichtiges Hormon. Sein Fehlen ist lebensbedrohend und bedarf in jedem Fall der Insulinersatztherapie. Die Suche nach Insulin begann nach der Beobachtung einer hochgradigen Glukosurie nach Entfernung der Bauchspeicheldrüse durch J. von Mering und O. Minkowski (1889) und wurde, zunächst durchaus erfolgreich, zuerst von I. Kleiner (USA) und N. Paulescu (Rumänien) aufgenommen. Der Durchbruch gelang 1921 in Toronto, wo F. Banting unter der Anleitung des Physiologen J. J. R. Macleod mit der alles entscheidenden Hilfe durch den Biochemiker J. Collip erstmals therapeutisch verwendbares tierisches Insulin isolierten. Von Bedeutung war auch die Mitarbeit des Studenten Ch. Best; er war für die aufwändigen Blutzuckerbestimmungen verantwortlich. Die erste klinische Anwendung von Insulin im Januar 1922 bei dem an Typ-1-Diabetes erkrankten, nur noch 30 kg schweren 14-jährigen Leonard Thompson, der bis 1935 überlebte, war ein voller Erfolg. Er wurde 1923 mit der Verleihung des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin an Banting und Macleod belohnt.
Vom Pankreas zum rekombinanten Humaninsulin
Das erste Insulin war ein brauner Extrakt aus Rinderpankreas. Er musste mehrmals täglich verabreicht werden und wirkte infolge verschiedenster Eiweißbeimengungen protrahiert. Seine Anwendung ermöglichte das Überleben, war aber in Abwesenheit jeglicher Möglichkeit einer Blutglukoseselbstkontrolle nicht steuerbar und oft von immunologischen Reaktionen, Hypo- und Hyperglykämien sowie von der Entwicklung schwerer diabetischer Spätkomplikationen begleitet.
Mit der Verfügbarkeit des ersten Insulins ergab sich somit zwingend die Notwendigkeit,
- Insulin von Fremdeiweiß zu reinigen und zu standardisieren
- den therapeutischen Vorgaben entsprechende Insulinwirkprofile zu entwickeln
- Strategien für eine adäquate Abstimmung von Nahrungsaufnahme und subkutaner Insulinzufuhr zu konzipieren
- Wege für eine möglichst patientennahe Blutzuckerüberwachung zu finden
Die angesprochenen Probleme sind heute weitgehend gelöst, doch war der Weg mühsam. Am Anfang stand die Standardisierung von Insulin mittels Konvulsionstest, gefolgt von seiner Kristallisation (J. J. Abel, 1926) und Synthese (F. Sanger, 1955). Weitere wichtige Schritte waren die Herstellung von Monospezies- (1967) und Monokomponenteninsulin (1970), das frei von Proinsulin und C-Peptid war, sowie die gentechnische Produktion von Humaninsulin (1979). Dieser letzte Schritt löste das Problem allergischer Insulinreaktionen und des potenziellen Insulinmangels endgültig.
Insuline mit unterschiedlichem Wirkprofil
Die Suche nach Insulinen mit unterschiedlichem Wirkprofil verlief parallel und resultierte zunächst in der Herstellung von kurz wirksamem „Altinsulin“. Es wurde später durch Beimengung von Protamin und Zink (Hagedorn, 1936), Globin oder Surfen oder durch Änderung der Insulinkristallgröße („Lente“-Insuline) in lang wirksames Insulin umgewandelt. Diese galenisch unterschiedlichen Insuline wurden ab 1991 durch solche mit veränderter Molekülstruktur und unterschiedlichen Wirkprofilen, so genannte Insulinanaloga, ersetzt. Sie dienen heute entweder als Langzeitinsuline (Insulin glargin, Insulin detemir) zur Deckung des nahrungsunabhängigen Basalinsulinbedarfs (etwa 1 IE/Stunde) oder als unmittelbar vor der Mahlzeit zu verabreichende, ultrakurz wirkende Insuline (Insulin lispro, Insulin aspart, Insulin glulisin) zur Substitution des essensbezogen erforderlichen Insulins. Schwierig ist allerdings nach wie vor die Abschätzung der jeweils richtigen Insulindosis, da diese nicht nur von der Art und Qualität der verzehrten Nahrung, sondern auch von der Insulinempfindlichkeit, dem Trainingszustand und der Resorptionsgeschwindigkeit des injizierten Insulins abhängt.
Strategien der Insulintherapie
Die Strategie der Insulintherapie war anfangs einfach, da nur kurz wirksames Altinsulin verfügbar war, das mehrfach täglich injiziert werden musste. Dies änderte sich mit der Verfügbarkeit des ersten Langzeitinsulins. Sie nährte die irrtümliche Vorstellung, dass der tägliche Insulinbedarf nun durch eine oder zwei Injektionen eines NPH-Insulins oder auch eines aus NPH- und Altinsulin zusammengesetzten Mischinsulins (2/3 der Tagesdosis morgens, 1/3 abends) gedeckt werden könnte. Diese später als konventionelle Insulintherapie bezeichnete Strategie ist eine lebensrettende Komaprophylaxe und dominierte die Behandlung des Typ-1-Diabetes bis etwa 1980. Sie zwingt den Patienten in das Korsett einer starren Insulindosierung sowie regelmäßiger, standardisierter Mahlzeiten, bietet aber kaum die Möglichkeit einer Steuerung.
Demgegenüber wirkte die von K. Stolte entwickelte und ab 1929 bei diabetischen Kindern erfolgreich eingesetzte „bedarfsgerechte Insulintherapie bei freier Kost“ revolutionär. Sie war rational und verbesserte die Lebensqualität der Kinder, wurde jedoch von den Diabetologen seiner Zeit vehement als „Leichtsinn“ bezeichnet und strikt abgelehnt. Ursachen dafür waren ein mangelhaftes Wissen über physiologische Zusammenhänge und – dem Zeitgeist entsprechend – die dominierende Wahrnehmung einer paternalistischen Arztrolle. Die Richtigkeit der von Stolte vorweggenommenen Strategie einer intensivierten Insulintherapie bestätigte sich 50 Jahre später mit Zunahme des Wissens über die physiologische Dynamik der Insulinsekretion, wozu meine frühere Klinik (ab 1979) wesentliche Beiträge leisten konnte, und durch die von Laien bei der Überwachung der Insulintherapie mittels Blutzuckerselbstmessungen gesammelten Erfahrungen (R. K. Bernstein, 1981).
Die Umsetzung der um 1980 wieder entdeckten intensivierten Insulintherapie in der täglichen Praxis wurde durch die nahezu zeitgleiche Ermöglichung der Blutglukoseselbstmessung massiv begünstigt. Hilfreich war aber auch die Bereitstellung von atraumatischen Nadeln zur Blutgewinnung, von Insulinpens für die Insulininjektion, von tragbaren Infusionsgeräten für die subkutane Insulininfusion („Insulinpumpen“) sowie die Modularisierung der Patientenausbildung („Diabetesschulung“). Sie ermöglichte die schrittweise Delegation therapeutischer Verantwortung an den insulinpflichtigen Patienten (M. Berger, 1983).
Heute steht somit außer der konventionellen Insulintherapie, die nun neben der Basalinsulin-unterstützten oralen Therapie (BOT) überwiegend bei älteren, eine einfache Therapieform bevorzugenden Patienten mit insulinpflichtigem Typ-2-Diabetes zur Anwendung kommt, mit der intensivierten Insulintherapie eine zweite, aufwändigere Strategie zur Verfügung. Sie wird vor allem Patienten mit Typ-1-Diabetes angeboten und in Form einer konventionell-intensivierten Insulintherapie sowie als funktionelle Insulintherapie (FIT) bzw. Basis-Bolus-Therapie (BBT) eingesetzt.
Spezifische Anforderungen der verschiedenen Insulinstrategien
Die Grundprinzipien der den physiologischen Gegebenheiten angenäherten Funktionellen Insulintherapie sind:
- die getrennte Substitution von basalem (essensunabhängigem, ca. 1 IE/Stunde) und prandialem (essensabhängigem) Insulinbedarf
- eine mindestens 4-mal tägliche Blutzuckerselbstmessung
- die selbstständige Korrektur eines vom vorgegebenen Zielkorridor (z. B. 110 bis 180 mg/dl) wesentlich abweichenden Blutzuckers durch den Patienten
Die Insulinzufuhr kann dabei entweder durch multiple Insulininjektionen, getrennt für Langzeitinsulin und kurz wirksames Insulin oder durch eine entsprechend programmierte Insulinpumpe („Insulinpumpentherapie“) erfolgen. Der für eine funktionelle Insulintherapie (oder Basis-Bol
us-Therapie) erforderliche Aufwand ist beträchtlich und bedarf einer gediegenen Patientenausbildung. Reicht die Motivation dafür nicht aus, kann auf eine konventionell-intensivierte Insulintherapie ausgewichen werden. Sie kombiniert Elemente der funktionellen Insulintherapie, wie die Trennung von basalem und prandialem Insulin, mit solchen einer konventionellen Therapie, wie einem teilfixiertem Diätplan und einer geringeren Zahl an Blutzuckermessungen/-korrekturen je Tag. Die Entscheidung über die anzupeilende Blutzuckerkontrolle und die dafür erforderliche therapeutische Strategie ist stets gemeinsam mit dem Patienten zu treffen, da nur so seine Motivation zur Mitarbeit und damit der Behandlungserfolg sichergestellt werden kann.