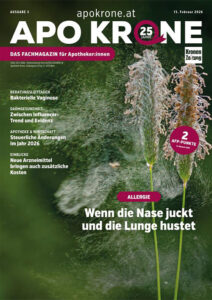Wann und wie richtig behandeln?
Sind mehr als 3 Gelenke (typischerweise Finger-, Daumen-, Knie-, Hüft- oder Wirbelgelenke) gleichzeitig von Arthrose betroffen, handelt es sich um Polyarthrose. Die Polyarthrose gehört zu den häufigsten Formen der Arthrose bei älteren Menschen und entwickelt sich meist schleichend.
Fingerpolyarthrose
Die Fingerpolyarthrose ist eine degenerative, chronisch progrediente Erkrankung mehrerer Fingergelenke. Typischerweise betroffen sind die Finger: Mittel- und Endgelenke sowie häufig auch das Daumensattelgelenk. Veränderungen an den Fingergelenken sind im höheren Lebensalter häufig und gelten teilweise als altersphysiologisch, da die Hände ein Leben lang als hoch beanspruchte „Werkzeuge“ im Einsatz sind.
Klinisches Erscheinungsbild
- Belastungs- und Bewegungsschmerzen
- kurze Morgensteifigkeit (10 Minuten)
- Funktionseinschränkungen (z. B. Greifschwierigkeiten)
- harte knotige Veränderungen (Fachjargon: Heberden-Knoten und Bouchard-Knoten)
- Die Fingergrundgelenke sind in der Regel nicht betroffen!
Zur Diagnosefindung werden in Rheumatologie und Orthopädie primär bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT oder MRT eingesetzt. Der Gelenksonografie kommt – bei entsprechender Expertise – eine besondere Bedeutung zu: Sie ist schnell, kosteneffizient und erlaubt eine dynamische Beurteilung von Gelenkstrukturen oder etwaigen Ergussbildungen.
Zentral ist die Erkenntnis, dass Knorpelgewebe keine regenerative Kapazität aufweist. Aufgrund seiner fehlenden Vaskularisierung ist der Knorpel somit auf die Ernährung durch Synovialflüssigkeit angewiesen – ein Prozess, der ausschließlich über Gelenkbewegung ermöglicht wird. Daraus ergibt sich die hohe Relevanz körperlicher Aktivität für die Erhaltung von Knorpelhomöostase. Knöcherne Anpassungen können im Rahmen chronischer Belastung oder Verletzungen erfolgen – der Knorpel hingegen bleibt verletzungsanfällig. Die Grenzfläche zwischen subchondralem Knochen und Knorpel ist Gegenstand intensiver Forschung, da sie maßgeblich an der Pathogenese beteiligt ist.
Zahlreiche Medienberichte suggerieren die Möglichkeit einer „Knorpelregeneration“ durch Nahrungsergänzung. Aus physiologischer Sicht ist jedoch fraglich, wie überhaupt relevante Mengen solcher Substanzen den avaskulären Fingerknorpel erreichen sollen. Lokale Infiltrationen direkt ins Gelenk sind am Kniegelenk sicher einer Überlegung wert, stellen aber bei den 20 Fingergelenken nur einen begrenzten Therapieansatz dar. Die oftmals kraftvolle Beugung und „Überstreckung“ bei Steifigkeit kann zu mikroskopischen Einrissen im Bereich der Kapsel und Knorpel führen; die Kraft, die Finger zu beugen, liegt in den Muskeln der Unterarme. Somit wird als effektive Therapiemaßnahme bei Fingerarthrose die physikalische Therapie angeführt – da ist sich die internationale Gemeinschaft einig. Für Knorpelschutzpräparate, sogenannte Chondroprotektiva, findet sich hingegen keine Evidenz für Effektivität, angereichertes Plasma ist bei Fingerarthrosen als experimentell zu bezeichnen.
Physikalische Therapie bei Fingerpolyarthrosen
- Wärme-/Kälte-Anwendungen (je nach Stadium)
- gezielte Mobilisation
- Ergotherapie (großes Potenzial zur Beschwerdelinderung)
- gelenkschonende Bewegung (z. B. Kneten, Greifübungen)
- Orthesen in der Nacht zur Ruhigstellung
Latente vs. aktivierte Fingerarthrose
Der Übergang von latenter zur aktivierten Arthrose ist fließend und mitunter wechselhaft.
Latente Arthrose (harte Knoten):
- geringe bis keine Schmerzen
- Funktion meist erhalten
- gelegentliche Steifigkeit, besonders morgens („Anlaufschmerz“)
- beginnende Knotenbildung (z. B. Heberden-Knoten)
Aktivierte Arthrose (weiche Schwellung):
- akute Schmerzphase, oft ausgelöst durch Belastung oder Mikroläsionen
- Schwellung, Rötung, Überwärmung des Gelenkes (Entzündung)
- eingeschränkte Beweglichkeit
- funktionelle Beeinträchtigung durch Gelenkerguss
Medikamentöse und chirurgische Therapie bei Fingerpolyarthrosen
In der entzündlichen Phase sind entzündungshemmende Medikamente wie nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) oder Glukokortikoide sinnvoll. Letztere können auch lokal ins entzündete Gelenk injiziert werden, sind aber keine dauerhaften Lösungsansätze.
Ein chirurgischer Eingriff ist meist Ultima Ratio und sollte gut abgewogen werden. Am erfolgversprechendsten ist die Operation des Daumensattelgelenkes. Die Ergebnisse bei Arthroplastiken oder Arthrodesen an den Fingergelenken hängen stark von der Compliance ab, diese sind aber sicher sinnvoller als eine dauerhafte Medikation!
Differenzialdiagnosen beachten
Nicht jede Polyarthrose ist eine „normale Abnützung“. Differenzialdiagnostisch müssen folgende Erkrankungen in Betracht gezogen werden:
- Alters- oder auch die Pfropf-Polyarthritis
- Kristallarthropathien (z. B. Gicht, Chondrokalzinose)
- rheumatoide Arthritis oder Psoriasisarthritis
Fazit
Fingerpolyarthrosen sind häufig und können zu funktionellen Beeinträchtigungen führen. Der Knorpel ist nicht regenerationsfähig, weshalb Bewegung, funktionelle Therapie und gezielte Entzündungshemmung im Vordergrund stehen. Chondroprotektiva zeigen keine klinisch relevante Wirkung. Operative Maßnahmen sind individuell zu prüfen.