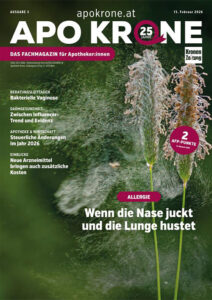Das Kreuz mit den Kreuzschmerzen
Die axiale Spondyloarthritis (axSpA) ist die häufigste Form der Spondyloarthritiden und manifestiert sich in der Regel vor dem 45. Lebensjahr. In der allgemeinmedizinischen Praxis stellt sie eine wichtige Differenzialdiagnose zum unspezifischen Rückenschmerz dar. Die Prävalenz liegt in Europa bei 0,1–0,4 %, abhängig von der Verbreitung des HLA-B27-Gens.
Pathophysiologie
Die axSpA ist eine immunvermittelte, genetisch beeinflusste Erkrankung, die vor allem durch Entzündungen an Enthesen – den Ansatzstellen von Sehnen und Bändern – sowie angrenzendem Knochengewebe gekennzeichnet ist. Das HLA-B27-Gen spielt eine zentrale Rolle in der Pathogenese. Entzündliche Prozesse führen über Zytokine wie TNF-α und IL-17 zu Gewebezerstörung mit anschließender Knochenneubildung, was unbehandelt zu Versteifungen der Wirbelsäule und erheblichen Bewegungseinschränkungen führen kann.
Klinik
Leitsymptom ist der entzündliche Rückenschmerz: schleichender Beginn, Besserung durch Bewegung (nicht durch Ruhe), bevorzugtes Auftreten in der zweiten Nachthälfte. Weitere Hinweise sind eine Morgensteifigkeit von über 30 Minuten sowie wechselnder Gesäßschmerz. Extraaxiale Manifestationen wie Uveitis, Enthesitiden (z. B. Ferse), periphere Arthritiden oder gastrointestinale Symptome werden bei einem Teil der Patient:innen beobachtet.
Trotz aktiver Entzündung sind Laborwerte wie CRP oder BSG nur bei etwa 50 % der Patient:innen erhöht. Die Magnetresonanztomografie – insbesondere fettsupprimierte T2-gewichtete Sequenzen – ist heute das wichtigste bildgebende Verfahren, um frühe entzündliche Veränderungen in den Sakroiliakalgelenken oder der Wirbelsäule nachzuweisen.
Verlauf und Komplikationen
Ohne adäquate Therapie kann es über Metaplasie zu Knochenneubildungen mit Sklerosierungen, Syndesmophyten und letztlich Ankylosen kommen. Dies führt zu einer irreversiblen Bewegungseinschränkung. Typische Komorbiditäten sind Osteoporose, Depression, Asthma und Schlafapnoe.
Diagnostik
Die Diagnose stützt sich auf Klinik, Bildgebung, Labor (inkl. HLA-B27) und Begleitmanifestationen. Der entzündliche Rückenschmerz hat diagnostisch einen zentralen Stellenwert und rechtfertigt eine weiterführende Diagnostik. Ein fehlendes Ansprechen auf NSAR, ein negatives HLA-B27 sowie das Fehlen typischer Symptome sprechen gegen eine axSpA.
Therapie
Ziel ist die Remission oder zumindest eine niedrige Krankheitsaktivität, gemessen am Aktivitätsscore. Neben Bewegungstherapie (z. B. Bechterew-Gymnastik) und Rauchstopp sind NSAR Mittel der ersten Wahl. Bei unzureichender Wirkung kommen Biologika zum Einsatz:
- TNF-α-Inhibitoren (Adalimumab, Etanercept u. a.): hohe Wirksamkeit bei r-axSpA, Uveitis und CED. Vor Therapiebeginn ist ein Infektionsscreening, insbesondere auf latente Tuberkulose, erforderlich.
- IL-17-Inhibitoren (Secukinumab, Ixekizumab, Bimekizumab): gleichwertig zu TNF-α-Inhibitoren, mit Vorteilen bei begleitender Psoriasis, jedoch nicht bei CED oder Uveitis
- JAK-Inhibitoren (Upadacitinib, Tofacitinib): neue Option mit guter Wirksamkeit. Vorsicht ist geboten bei kardiovaskulären Risikofaktoren und erhöhtem Herpes-Zoster-Risiko.
Eine Therapiereduktion ist bei stabiler Remission möglich, ein vollständiges Absetzen führt jedoch häufig zu einem Rezidiv.