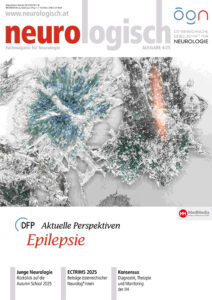Berücksichtigt man Krankheitslast und die damit verbundenen Folgen (fehlende Teilhabe am Leben, reduzierte Lebensqualität, generelle Funktionalität) sowie gesellschaftliche Aspekte, dann belegen Depressionen seit Jahren Platz 1 unter allen Erkrankungen. Dies kann man in den „Burden of Disease“-Studien nachlesen. Oftmals imponieren depressive Erkrankungen jedoch nicht eindeutig oder sind nicht immer einfach zu entdecken, da es sehr häufig zu Überlappungen von Symptomen bei den verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbildern kommt. Zudem können mehrere Erkrankungen gleichzeitig bestehen, wobei die dominierende Erkrankung das weniger ausgeprägt manifestierende Krankheitsbild überschatten kann.
Weg in die Behandlung ist schwer
Nur etwa 50 % aller an Depression erkrankten Menschen werden behandelt. Teilweise liegt das an der Stigmatisierung und damit verbundenen Angst, über psychiatrische Beschwerden zu sprechen. Es ist bekannt, dass nur rund 10 % der an einer Depression erkrankten Menschen in der Hausarztpraxis diagnostiziert und behandelt werden. Ebenfalls nur 10% der an einer Alkoholkonsumstörung leidenden Menschen finden den Weg in adäquate Behandlung. Dies ist klinisch besonders relevant, da Alkoholkonsumstörungen nach Angsterkrankungen zu den häufigsten Komorbiditäten depressiver Erkrankungen zählen.
Depression und Komorbiditäten
Zu den häufigsten Komorbiditäten von depressiven Erkrankungen zählen Angsterkrankungen. Eine weitere Gruppe sind Suchterkrankungen, allen voran die Alkoholkonsumstörung, sowie auch der schädliche Gebrauch von Benzodiazepinen. Außerdem finden sich Persönlichkeitsstörungen, ADHS und Traumafolgestörungen mit depressiven Erkrankungen vergesellschaftet.
Auch körperliche Erkrankungen wie chronische Schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen treten in sehr vielen Fällen komorbid zur Depression auf. Im geriatrischen Kontext kann die Zuordnung von kognitiven Defiziten herausfordernd sein, da diese sowohl durch Depression als auch durch neurodegenerative Entwicklungen hervorgerufen werden können. Werden die kognitiven Defizite von Betroffenen eher bagatellisiert, deutet dies eher auf eine demenzielle Entwicklung hin. In diesen Fällen kommen die Betroffenen häufig nicht aus Eigeninitiative zu uns und werden von Angehörigen begleitet, während depressiv Erkrankte hingegen sehr oft gezielt auf die Defizite hinweisen.
Differenzialdiagnostisch wichtig ist auch die ätiologische Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Erkrankung. Eine Depression kann auch durch eine andere chronische Erkrankung, wie es z. B. sehr häufig beim metabolischen Syndrom der Fall ist, getriggert werden – und umgekehrt. Die Wechselwirkungen sind komplex und bidirektional.
Dualdiagnosen: wenn Sucht und Depression zusammentreffen
Beeinflussen sich psychiatrische Erkrankungen wechselseitig, was sehr häufig bei Depression und Substanzgebrauchsstörungen der Fall ist, handelt es sich um sogenannte Dualdiagnosen, die mit einer deutlich erhöhten Morbiditäts- und Mortalitätsrate einhergehen. Internationale Studien zeigen, dass über die Hälfte der Menschen mit einer Suchterkrankung auch an einer weiteren psychiatrischen Erkrankung leidet. Diese Konstellationen stellen präzise Anforderungen an Diagnostik, Therapie und Versorgungssysteme.
Die Ursachen sind vielfältig: Manche Menschen greifen zu Suchtmitteln, um Symptome einer psychiatrischen Erkrankung, beispielsweise einer Depression oder einer Angsterkrankung, zu lindern – etwa als eine Art „Selbstmedikation“ zur Beruhigung bzw. Bekämpfung depressiver Beschwerden oder Angstsymptome, oder zur Flucht aus belastenden Gefühlen und Situationen. Umgekehrt kann der Konsum von Substanzen Depressionen oder Angsterkrankungen triggern, was besonders häufig der Fall ist, wenn der Konsum länger besteht und immer mehr Raum im Leben der Betroffenen einnimmt.
Diagnostische Herausforderungen
Die Diagnostik bei komorbiden Erkrankungen sollte aufmerksam erfolgen. Symptome können sich überlagern oder gegenseitig verstärken. Beispielsweise kann eine depressive Symptomatik durch den Konsum von Alkohol entweder maskiert oder verstärkt werden. Beide Phänomene werden beispielsweise bei einer akuten Alkoholintoxikation häufig beobachtet. Eine genaue Anamnese, die Berücksichtigung von Konsummustern und eine differenzierte Diagnostik inklusive klinischer Untersuchung mit Labordiagnostik sowie Zuweisung an Fachärzt:innen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und Expert:innen weiterer medizinischer Fachdisziplinen wie z. B. Fachärzt:innen für Innere Medizin sind hierbei essenziell.
Besonders bei Dualdiagnosen ist es wichtig, nicht nur die Sucht oder nicht nur die Depression zu behandeln, sondern beide bzw. häufig auch mehrere Aspekte (z. B. Suchterkrankung, Angsterkrankung, Depression, Leberfunktionsstörung, chronische Gastritis) gleichzeitig zu berücksichtigen. Eine isolierte Diagnostik und Behandlung führen oft zu unzureichender Stabilisierung bzw. Rückfällen.
Therapeutische Strategien
Die Behandlung von Dualdiagnosen bzw. von Depressionen mit Komorbiditäten erfordert ein multi- und interdisziplinäres Vorgehen, das je nach Schweregrad der vorliegenden Erkrankungen ambulant bzw. stationär erfolgt. Psychopharmakotherapie, Psychotherapie und sozialtherapeutische Unterstützung müssen eng verzahnt sein. Aufgrund der häufig begleitenden Erkrankungen weiterer Organsysteme ist eine gleichzeitige fachärztlich-internistische Behandlung unentbehrlich. Hierbei können spezialisierte Einrichtungen besonders wertvoll sein. Durch das Angebot solcher inter- und multidisziplinären Expertise im Rahmen integrierter Therapieprogramme, die auf die komplexen Bedürfnisse der Betroffenen individuell eingehen, wurden bessere und nachhaltigere Behandlungsergebnisse wiederholt beobachtet.
Um eine bestmögliche Lebensqualität und Funktionalität der Betroffenen langfristig zu erhalten, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen stationären und ambulanten Einrichtungen von zentraler Bedeutung. Besonders nach Beendigung eines stationären Aufenthalts besteht ein erhöhtes Rückfallrisiko, wenn keine ausreichende ambulante Weiterbetreuung gewährleistet ist. Zur Stabilisierung können zusätzliche therapeutische Maßnahmen beitragen – etwa die Anbindung an Selbsthilfegruppen sowie auch der gezielte Einsatz von Bibliotherapie und elektronischen bzw. digitalen Therapietools.
Fazit
Depressionen mit Komorbiditäten bzw. Dualdiagnosen sind keine Ausnahme, sondern häufige Realität in der psychiatrischen Praxis. Die Komplexität dieser Krankheitsbilder erfordert ein hohes Maß an diagnostischer Sorgfalt und multi- sowie interdisziplinärer Zusammenarbeit. Durch ein ganzheitliches Verständnis und eine individuell abgestimmte Behandlung können Betroffene langfristig stabilisiert und in ihrer Lebensqualität sowie Funktionalität substanziell verbessert werden. Hierbei gilt, dass im Falle einer rechtzeitigen Erkennung und einer adäquaten Behandlung von einer sehr guten Prognose ausgegangen werden kann. Darüber hinaus kommt der Qualität der Arzt-Patienten-Beziehung eine herausragende Bedeutung zu. Eine tragfähige therapeutische Allianz fördert nachweislich die Therapieadhärenz und verbessert die Behandlungsoutcomes – sowohl im akuten Setting als auch im längerfristigen Verlauf.