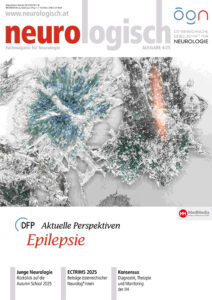Der Countdown läuft
Im European Health Report 2024 wird festgestellt, dass fehlende Daten aus dem Gesundheitswesen zu einem Großteil dafür verantwortlich sind, dass es politische Entscheidungstragende schwer haben, rechtzeitig effiziente Entscheidungen für die Gesundheitsplanung treffen zu können. Genau hier setzt der European Health Data Space (EHDS) mit der Vision an, das europäische Gesundheitssystem nachhaltig weiterzuentwickeln und dabei das Solidaritätsprinzip zu wahren.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.): Dr. Hans Georg Mustafa, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie, Dr. Alexander Moussa, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin (ÖÄK), Helene Prenner, MA (ELGA GmbH), Mag.a (FH) Ing.in Christine Stadler-Häbich, AUSTROMED Vorstandsmitglied für Digitalisierung (Moderation), Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó (Universität Wien), Mag. Herwig Loidl, MBA MSc (WKO)
„In Österreich haben wir mit ELGA bereits ein System, das den Zugriff auf Gesundheitsdaten ermöglicht, allerdings nicht in dem Umfang, wie es für eine ganzheitliche Versorgung nötig wäre“, sagt Helene Prenner, MA, Leiterin des Kompetenzzentrums für internationale Projekte in der ELGA GmbH. Doch es scheint kein österreichisches Novum zu sein, dass Patientinnen und Patienten auf eigene Daten nicht zugreifen können oder Leistungserbringende häufig nicht ausreichend angebunden sind. „Die WHO und die EU haben erkannt, dass hier ein strukturierter, interoperabler Raum notwendig ist, in dem Daten europaweit sicher und standardisiert ausgetauscht werden können“, bringt es Prenner auf den Punkt. Der EHDS widmet sich dazu drei zentralen Herausforderungen: der Primärdatennutzung, der Sekundärdatennutzung und der technischen Standardisierung. Ohne einheitliche Schnittstellen, Formate und semantische Standards ist ein europaweiter Datenraum nicht realisierbar. Der EHDS setzt hier klare Vorgaben für Softwarehersteller und Gesundheitseinrichtungen.
DSGVO: „Weapon of Mass Destruction“
Im Zentrum der Diskussion um Gesundheitsdaten steht hierzulande nach wie vor die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), doch mittlerweile ist eine Vielzahl weiterer Rechtsakte hinzugekommen: Der Digital Services Act (DAS) schafft Regeln für Transparenz und Verantwortung digitaler Plattformen, der Digital Markets Act (DMA) regelt das Verhalten marktbeherrschender „Gatekeeper“ zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen, der Data Governance Act (DGA) fördert die freiwillige Datennutzung über vertrauenswürdige Vermittlungsstellen, der Data Act (DA) regelt Zugriffs- und Nutzungsrechte von Daten und der Artificial Intelligence Act (AIA) umfasst risikobasierte Regeln für den Einsatz von KI-Systemen. Dazu kommen NIS 2, eine EU-Richtlinie zu Cybersicherheitsstandards, insbesondere in kritischen Infrastrukturen, oder der Digital Operational Resilience Act (DORA), der die digitale Resilienz im Finanzsektor, insbesondere in Bezug auf IKT-Risiken, adressiert.
„Diese Regelwerke überlagern einander, ergänzen einander und schaffen häufig auch neue Unklarheiten und Vollzugsdefizite, insbesondere dort, wo technische Umsetzung, Datenschutz, sektorspezifische Bedürfnisse und politische Ziele zusammentreffen“, ist Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó, Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien, überzeugt. „Nachdem die DSGVO stets anwendbar ist, steht damit jede Initiative zur Nutzung personenbezogener Gesundheitsdaten unter dem Vorbehalt der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit. In der Praxis ist die DSGVO dabei oft eine ‚Weapon of Mass Destruction‘, die jede Diskussion rasch beenden kann“, ergänzt Forgó und beschreibt eine Reihe von Unklarheiten: „Behandelnde wollen schnellstmöglichen Zugang zu den relevanten Daten, wissen aber oft nicht, was erlaubt ist. Dateninhabende möchten oft kooperieren, unterliegen aber ebenfalls Unsicherheiten im Umgang mit der DSGVO, und schließlich fordern Forschende den Zugang zu den Daten für die Sekundärnutzung, doch auch ihnen ist oft nicht klar, unter welchen Bedingungen das erlaubt ist.“ Am Ende entstehen statt interoperabler Systeme oft Silos und wertvolle öffentliche Mittel versanden in Pilotprojekten, die nicht skaliert werden können.
Der EHDS bringt nicht nur technische und organisatorische Neuerungen, sondern erweitert auch den Rechtekatalog für Patientinnen und Patienten, allen voran stellt die Verordnung klar: Die DSGVO bleibt voll anwendbar, aber es kommen zusätzliche Betroffenenrechte hinzu, wie etwa das Recht auf analoge Ausfertigungen oder der kostenlose Zugang zu Gesundheitsdaten über nationale Zugangsportale. Und das wirft neue Fragen auf, denn der kostenlose Zugang für Patientinnen und Patienten zu ihren Daten muss auch finanziert werden.
Herausforderungen auf vielen Ebenen
Interoperabilität wird in allen Bereichen gefordert. Standards müssen strikt eingehalten werden und Systeme, die künftig auf den Markt kommen oder weiterhin betrieben werden, müssen interoperabel sein. Damit betrifft der EHDS nicht nur Neuentwicklungen, sondern auch bestehende Produkte, die an die neuen Anforderungen angepasst werden müssen. Mag. Herwig Loidl, MBA, MSc, Sprecher des Arbeitskreises e-Health in der Wirtschaftskammer Österreich, sieht das aber nicht nur als Nachteil: „Wird Interoperabilität richtig umgesetzt, können Budgets effizienter genutzt werden, weil redundante Schnittstellen und teure Insellösungen entfallen.“ Zudem werden damit erstmals einheitliche Qualitätsvorgaben für Gesundheits-IT-Systeme geschaffen und die digitale Zusammenarbeit wird erleichtert.
Daten müssen intelligent genutzt werden
In der Podiumsdiskussion, die von Mag.a (FH) Ing.in Christine Stadler-Häbich, AUSTROMED Vorstandsmitglied für Digitalisierung, moderiert wird, beschreiben die Mediziner Dr. Hans Georg Mustafa, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie, sowie Dr. Alexander Moussa, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin und zuständig für E-Health in Ordinationen in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), die Herausforderungen des EHDS aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte. „Wir nutzen pseudonymisierte Labordaten bereits jetzt, etwa Ergebnisse aus dem Liquid Profiling oder für die Anwendung künstlicher Intelligenz auf bestehende Blutbilddaten, um Krankheitsrisiken zu kalkulieren“, sagt Mustafa. Weitere konkrete Anwendungsbeispiele sind die Früherkennung der nicht-alkoholischen Fettleber oder die Alzheimer-Diagnostik. „Durch multiple Parameter und Algorithmen können Betroffene frühzeitig für Therapien identifiziert werden“, erklärt der Labormediziner.
Einig ist er sich mit Moussa, dass für den Erfolg des European Health Data Space (EHDS) die frühzeitige Einbindung von Ärztinnen und Ärzten von großer Bedeutung ist. „Wir dürfen im Prozess der Datennutzung nicht bloße Passagiere sein, sondern müssen als Piloten agieren: bei der korrekten Datenerhebung, der fundierten Interpretation sowie der Umsetzung in den Versorgungsalltag“, so Moussa. Er weist darauf hin, dass die Österreichische Ärztekammer zahlreiche Initiativen setzt, um die Mitglieder auf die Anforderungen der Digitalisierung vorzubereiten. Auch auf der Agenda der Österreichischen Gesellschaft für Telemedizin und E-Health stehen die Anforderungen des EHDS weit oben. „Es geht darum, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, wie Gesundheitsdaten erhoben, verwaltet und genutzt werden sollen, damit Vertrauen entsteht und die Patientinnen und Patienten ebenso wie die Ärztinnen und Ärzte vom EHDS profitieren können“, sagt Moussa abschließend.