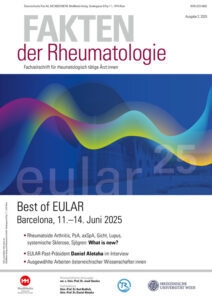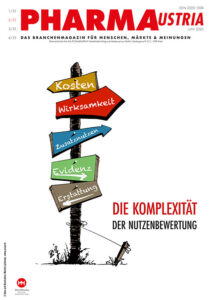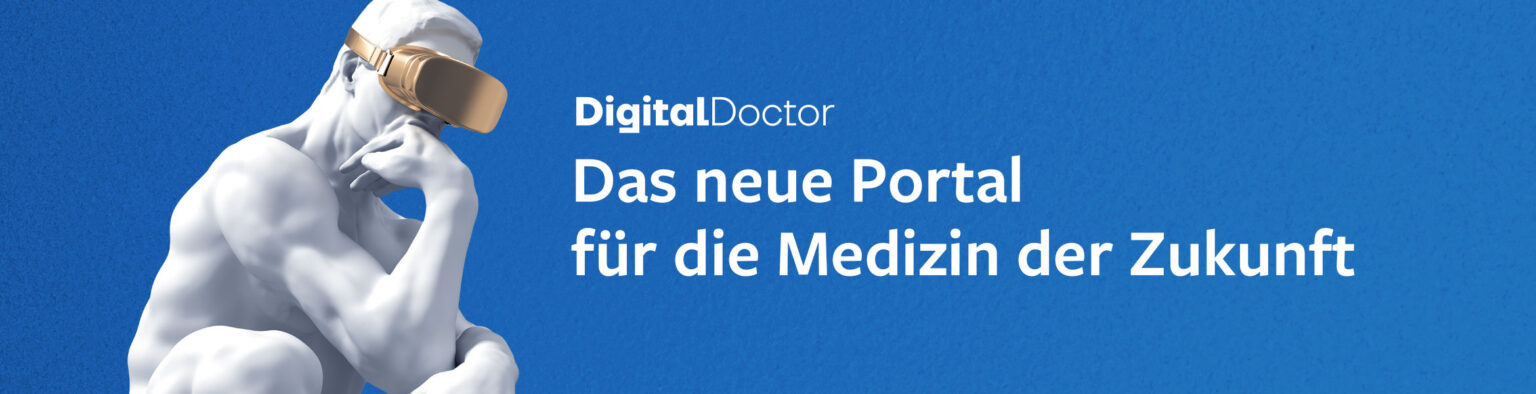„Von Fax zu App – es braucht moderne digitale Tools“
In der Serie „NEXT GENERATION“ beantworten junge Onkolog:innen fünf Fragen zu ihrem Berufsleben, die gemeinsam mit der Young Hematologists & Oncologists Group Austria (YHOGA) erarbeitet wurden. Dr. Simon Udovica von der 1. Medizinischen Abteilung, Zentrum für Onkologie und Hämatologie, Klinik Ottakring, Wien, spricht im Interview über die dringende Notwendigkeit moderner digitaler Lösungen im klinischen Alltag und darüber, warum die Anbindung an spezialisierte Zentren und wohnortnahe Versorgung Hand in Hand gehen müssen.
Welche Maßnahmen oder Ressourcen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um jungen Onkolog:innen ideale Ausbildungsbedingungen zu ermöglichen?
Dr. Simon Udovica: Ich würde das auf zwei Ebenen betrachten: Auf der Makroebene braucht es mehr Zeit und Aufmerksamkeit für die Ausbildung im klinischen Alltag, denn diese ist sehr zeitintensiv und anspruchsvoll. Es gibt bereits gute Ansätze, wie etwa die verstärkte Förderung von Fortbildungen. Besonders hilfreich sind die Fortbildungen, die speziell auf Jungärzt:innen zugeschnitten sind. Diese schaffen eine niedrigere Hemmschwelle, um Fragen zu stellen, und fördern den Austausch untereinander. Auf der Mikroebene ist eine offene Teamkultur entscheidend. Es ist enorm lehrreich, frühzeitig in Entscheidungen eingebunden zu werden, insbesondere bei komplexen Fällen, die nicht dem Lehrbuch entsprechen. Gleichzeitig muss es immer erfahrene Kolleg:innen geben, die als Back-up fungieren und mit denen man schwierige Entscheidungen besprechen kann.
Wie hat sich die onkologische Patientenversorgung im klinischen Alltag durch aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen verändert, und welche Herausforderungen entstehen dadurch?
Die Onkologie wird immer spezialisierter und komplexer. Es ist unrealistisch, dass eine einzelne Person alles abdecken kann. Es ist jedoch wichtig, eine breite Basisausbildung zu erhalten, Therapieentscheidungen sollten in spezialisierten Zentren getroffen werden, während die wohnortnahe Versorgung für Patient:innen gewährleistet bleibt. Die Schnittstelle zwischen großen Zentren und regionalen Einrichtungen muss reibungslos funktionieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ausbau des ambulanten und des tagesklinischen Bereichs. Hier spielen auch Case Manager und Cancer Nurses eine zentrale Rolle, um Patient:innen durch die vielen komplexen Abläufe zu begleiten.
Wie hat sich das Berufsbild der/des Onkolog:in in den letzten Jahren verändert, und inwiefern unterscheidet es sich heute von jenem der früheren Generationen?
Das Berufsbild ist aus meiner Sicht grundsätzlich gleichgeblieben, doch die Spezialisierung und Interdisziplinarität haben stark zugenommen. Onkolog:innen müssen heute nicht nur Therapiepläne erstellen, sondern diese auch zwischen verschiedenen Fachdisziplinen koordinieren. Ein Unterschied zwischen den Generationen zeigt sich in der Nutzung digitaler Tools: Jüngere Ärzt:innen greifen auf Apps oder Online-Ressourcen zurück, während diese Tools von älteren Kolleg:innen teilweise seltener genutzt werden. Trotz aller Veränderungen bleibt der Beruf herausfordernd, aber auch äußerst erfüllend. Es ist ein Privileg, Patient:innen in schwierigen Lebenssituationen zu begleiten und zu unterstützen.
Viele junge Onkolog:innen sind neben ihrer klinischen Arbeit auch wissenschaftlich tätig. Wie gelingt die Balance zwischen Klinik und Forschung?
Wissenschaftliche Arbeit ist wichtig, da sie uns ermöglicht, aktuelle Literatur zu analysieren und fundierte Einblicke in verschiedene Themen zu gewinnen. Auch kleinere Projekte wie Reviews oder Kongressberichte sind wertvoll. Sie müssen nicht unbedingt in großen Journals erscheinen, um einen Mehrwert zu bieten. Die Balance zwischen Klinik und Forschung ist jedoch manchmal schwierig. Oft bleibt nur wenig Zeit im Alltag für wissenschaftliche Arbeiten. Fest eingeplante Zeiten für Forschung würden die Vereinbarkeit erleichtern. Es ist entscheidend, die Verbindung zwischen klinischer Praxis und Wissenschaft zu halten, da beide Bereiche voneinander profitieren.
Wie schätzen Sie die Qualität der onkologischen Versorgung in Österreich im internationalen Vergleich ein? In welchen Bereichen besteht Verbesserungspotenzial?
Die onkologische Versorgung in Österreich ist auf einem sehr hohen Niveau. Der Zugang zu aktuellen Medikamenten ist durch das Gesundheitssystem gut abgesichert. Verbesserungspotenzial sehe ich vor allem in zwei Bereichen: Erstens sollten mehr Patient:innen in klinische Studien, insbesondere Phase-I- und -II-Studien, eingebunden werden. Zweitens ist die Digitalisierung ein großes Thema. Krankenhäuser nutzen immer noch Faxgeräte, was ineffizient und definitiv veraltet ist. Standardisierte IT-Systeme und eine bessere Datenerhebung könnten die Versorgung weiter verbessern.