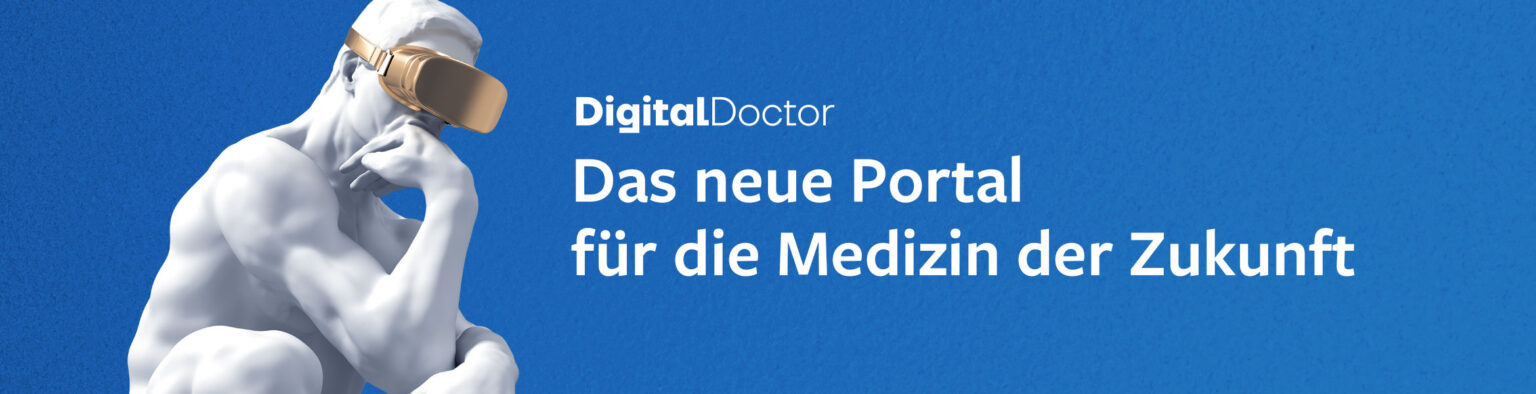Vorhofflimmern: digitale Früherkennungs- und Guidance-Strategie
Sollte ein systematisches Screening auf Vorhofflimmern (VHF) durchgeführt werden? Welche Screeninginstrumente sind optimal geeignet, und wie können diese möglichst flächendeckend eingesetzt werden? Führt ein digitales Screening- und Guidance-Programm letztlich zu einer Verbesserung klinischer Outcomes? Auf diese Fragen gibt es bislang keine eindeutigen, wissenschaftlich fundierten Antworten.
Das „Austrian Digital Heart Program“ mit seiner mobilen Applikation „Pulskontrolle“ – eine Initiative der Abteilung für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Universität Innsbruck, gefördert von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft mit rund 8 Millionen Euro – setzt genau hier an: Es soll neue Wege für die digitale Früherkennung und individualisierte Behandlungsbegleitung von Vorhofflimmern aufzeigen.
Problemstellung
VHF ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung und betrifft weltweit rund 59 Millionen Menschen. Prognosen zufolge wird sich die Zahl der über 55-Jährigen mit VHF in Europa bis 2060 mehr als verdoppeln. Österreich weist unter allen europäischen Ländern eine der höchsten altersstandardisierten Inzidenzen auf: bei Männern ca. 68 pro 100.000, bei Frauen ca. 52 pro 100.000.1
VHF erhöht nicht nur das Schlaganfallrisiko erheblich, sondern ist auch mit einer gesteigerten Wahrscheinlichkeit für Herzinsuffizienz, Krankenhausaufenthalte, kognitive Einschränkungen und eine erhöhte Mortalität verbunden. Ein zentrales Problem liegt in der rechtzeitigen Erkennung: VHF verläuft häufig asymptomatisch und tritt oft nur sporadisch auf. Der Anteil unerkannter Fälle wird auf 13–35 % geschätzt. Studien wie ASSERT haben zudem gezeigt, dass selbst subklinisches VHF mit einem signifikant erhöhten Schlaganfallrisiko einhergeht.1
Die bisherigen Screening-Studien fokussierten primär auf die Schlaganfallprävention. Ein ganzheitlicher Ansatz, der auch die Identifikation und Behandlung von Risikofaktoren und Begleiterkrankungen einschließt, fehlt bislang. Trotz intensiver Bemühungen konnte bisher keine Studie den überzeugenden klinischen Nutzen eines systematischen VHF-Screenings nachweisen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig; ein möglicher Grund ist aber der enge Fokus auf die orale Antikoagulation anstelle einer strukturierten Behandlung entlang des CARE-Pathways.Es besteht daher dringender Bedarf an neuen Strategien, die eine frühzeitige Diagnosestellung und eine darauf abgestimmte, effektive Behandlung ermöglichen.
Digitale Medizin als neue Chance
Digitale Screening-Strategien bieten vielversprechende Möglichkeiten, insbesondere durch die weite Verbreitung von Smartphones (~90 % der Bevölkerung). In der eBRAVE-AF-Studie konnte erstmals in einer randomisierten Untersuchung gezeigt werden, dass eine smartphonebasierte Screeningstrategie die Rate von neu diagnostiziertem, behandlungsrelevantem VHF im Vergleich zu „usual care“ mehr als verdoppelt.
Allerdings bleibt die Frage unbeantwortet, ob eine solche digitale Strategie auch zu einer Verbesserung klinischer Outcomes führt. Hier setzt das „Austrian Digital Heart Program“ an. Unter der Leitung der Universitätsklinik Innsbruck wird eine digitale, smartphonebasierte Screening- und Behandlungsstrategie entwickelt und in einer groß angelegten, randomisierten klinischen Studie evaluiert.
Studiendesign und Vorgehen
Gemeinsam mit dem Austrian Institute Of Technology und der Medizinischen Universität Graz werden maßgeschneiderte Software- und Hardwarelösungen entwickelt. Als zentraler digitaler Ankerpunkt wird dafür die mobile Applikation „Pulskontrolle“ entwickelt. Mittels optischer Technologie (Photoplethysmografie) kann der Herzrhythmus durch Auflegen eines Fingers auf die Smartphonekamera erfasst werden. Daraus wird eine Vortestwahrscheinlichkeit für das Vorliegen von VHF kalkuliert und mittels zugesandten Patch-EKGs verifiziert.
Die wichtigsten Merkmale dieser innovativen Studie sind:
- Integration ins öffentliche Gesundheitssystem über ELGA
- zentrumslose, digitale Rekrutierung und Begleitung durch das Studienzentrum
- Anwendbarkeit der digitalen Tools auf allen gängigen Smartphones
- tägliche Selbstmessung der Teilnehmer:innen mit Echtzeitanalyse des Herzrhythmus
- Verwendung eines strukturierten, digitalen Guidance-Moduls mit integrierter Telehealth Platform
Ziel ist es, zu zeigen, dass durch frühzeitige digitale Erkennung und individualisierte Behandlung von VHF die Schlaganfallrate signifikant reduziert werden kann.
Zukunftsperspektiven
Wenn sich der Ansatz des „Austrian Digital Heart Program“ bewährt, könnte dies einen Paradigmenwechsel in der kardiovaskulären Prävention einleiten. Digitale Screening- und Behandlungsprogramme könnten künftig nicht nur die Prognose bei VHF verbessern, sondern auch Modellcharakter für weitere Projekte der digitalen Medizin in der Kardiologie und darüber hinaus haben.
Resümee
Das „Austrian Digital Heart Program“ stellt einen innovativen Ansatz dar, um VHF frühzeitig zu erkennen und effektiv zu behandeln. Durch den Einsatz moderner digitaler Technologien und die Integration in bestehende Versorgungssysteme (via ÖGK und ELGA) könnte ein bedeutender Beitrag zur Reduktion von Schlaganfällen geleistet werden. Die Ergebnisse dieser groß angelegten Studie werden Aufschluss darüber geben, ob digitale Medizin neue Maßstäbe in der Prävention und im Screening setzen kann.