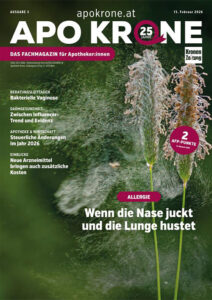Rauchstopp: realistisch, individuell und machbar – Wissenswertes und praktische Ansätze für ärztliche Beratung und Prävention
Keine Frage: Gar nicht erst mit dem Rauchen zu beginnen, wäre zweifellos der beste Weg. Doch die Realität zeigt: Suchtverhalten existiert seit jeher – und wird es auch in Zukunft geben. Wie ein Aufhören gelingen kann und wie Ärzte dabei wirksam unterstützen können, beschrieb Pulmologe Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Popp bei der Fortbildungsveranstaltung „Gesundheitsbewusstsein, Gesundheitskompetenz: was soll die Ärzteschaft den PatientInnen vermitteln“ der Gesellschaft der Ärzte in Wien.
Zigarettenrauchen zählt zu den bedeutendsten vermeidbaren Gesundheitsrisiken und Krankheitsursachen – und führt zu erheblichen Belastungen für das österreichische Gesundheitssystem. Etwa die Hälfte der Raucher erleidet bis zum 70. Lebensjahr einen schwerwiegenden Gesundheitsschaden oder stirbt an den Folgen des Tabakkonsums. Zu den häufigsten Folgeerkrankungen zählen Gefäß- und Lungenerkrankungen. Lungenkrebs betrifft etwa einen von 7 bis 8 Langzeitrauchern – meist erst nach über 30 Jahren Konsum. Das Krebsrisiko ist für „Standardraucher“ um das 20-Fache erhöht – das gilt nicht nur die Lunge, sondern auch für fast alle anderen Organe. Doch gerade weil die Folgen erst nach vielen Jahren auftreten, ist die Bedrohung oft schwer greifbar und wird nicht als unmittelbare Gefahr wahrgenommen.
Wirksame Primärprävention funktioniert nicht über Verbote oder moralische Appelle wie „Du darfst nicht“ oder „Du sollst nicht“. Stattdessen geht es um das Sichtbarmachen positiver Alternativen. In der Sekundärprävention steht das Bewusstmachen kurzfristiger positiver Effekte eines Rauchstopps im Vordergrund: das Erkennen der kurzfristigen Effekte, der Wille von Freiheit und nicht abhängig sein – egal ob von Alkohol, Zigaretten oder Verhaltensmustern. Angst hingegen ist selten hilfreich, zumal durch das Rauchen verursachte Schäden erst nach Jahrzehnten auftreten.
Sekundärprävention: Wege aus der Abhängigkeit
- Bewusstwerden und Wille zur Veränderung
Der erste Schritt ist das Erkennen der eigenen Abhängigkeit, verbunden mit einem ehrlichen Blick auf mögliche oder bereits eingetretene Gesundheitsschäden. Wichtig ist die Motivation zur Veränderung.
Ärzte können hier unterstützend wirken, indem sie das Rauchverhalten und die möglichen oder bereits vorhandenen Schäden aktiv und empathisch ansprechen, individuelle Auslöser (Zeitpunkt, Orte, Situationen) gemeinsam reflektieren und motivieren – ohne Druck oder Verbote.
- Rückfälle sind Teil des Prozesses
Ein Rückfall ist kein Versagen oder gar eine Schande, sondern ein normaler Bestandteil vieler erfolgreicher Suchttherapien. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss Rückschläge als Lernmomente begreifen.
Ärzte sollten Rückfälle oder einen inkompletten Erfolg offen ansprechen und Betroffene bestärken, weiterzumachen.
- Der richtige Weg ist individuell
Es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern viele Methoden zur Tabakentwöhnung. Jede kann richtig sein, wenn sie zur Person passt und zum Ziel führt. Die Möglichkeiten und Angebote sind vielfältig, von niederschwellig (z. B. Verhaltenstipps wie das Meiden von Kaffee, bei dem die erste Zigarette geraucht wird) über strukturierte Programme, Medikamente oder Ersatzprodukte. Entscheidend ist, dass es individuell passt. Die Ärzteschaft kann Impulse geben, unterstützen und begleiten.
- Wenn der Ausstieg nicht sofort gelingt: Schaden reduzieren und Alternativen finden
Das Konzept der „Harm Reduction“ (Schadensreduktion) kommt zwar aus der Psychiatrie und Drogenmedizin, ist aber auch in der allgemeinen Medizin ein bewährter Ansatz – wie die Verwendung von Sturzhelmen oder Sicherheitsgurten, Sonnencremen, Zuckerreduktion in Getränken etc. Wenn ein sofortiger Rauchstopp nicht möglich ist, können weniger schädliche Alternativen zur Verbrennungszigarette einen ersten wichtigen Schritt darstellen.
Harm Reduction: realistisch statt radikal
„Ganz oder gar nicht“ funktioniert für viele Menschen nicht. Forderungen wie „Quit or die“ oder Schuldzuweisungen wie „Selber schuld“ sind nicht nur demotivierend, sondern oft auch inhuman. Ein akzeptierbarer, umsetzbarer Schritt in Richtung weniger Schaden kann für viele Menschen mehr bewirken als das dogmatische Bestehen auf Totalverzicht. Das Konzept der Harm Reduction beruht auf der Akzeptanz einer Maßnahme die weniger schädlich, aber in der Umsetzung realistischer als der komplette Rauchstopp erscheint. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert Schweden: Durch harm-reduction-orientierte Maßnahmen konnte die Zahl der Raucher auf 5 % gesenkt werden – mit entsprechend rückläufigen Erkrankungsraten bis hin zum Lungenkrebs.
Laut einer umfassenden Datenanalyse (siehe Cochrane Library) liegen die Erfolgsquoten verschiedener Rauchstopp-Methoden wie folgt:
- Motivierende Gespräche und ärztlicher Rat: Odds Ratio (OR) 1,5–1,7
- Nikotinersatztherapien (Sublingualtabletten, Inhalatoren, Pflaster): OR ca. 1,7
- Vareniclin (medikamentös) und E-Zigaretten: OR ca. 2,3
Nikotinbeutel sind nicht als Ersatztherapie in der Apotheke, sondern in Trafiken frei erhältlich. Sie enthalten in der Regel Nikotin in Arzneimittelqualität und stellen eine niederschwellige, wirksame Alternative für Raucher dar, die den Ausstieg aus der Tabakabhängigkeit anstreben.
Auch E-Zigaretten und Tabakerhitzer gelten als deutlich weniger schadstoffbelastet als klassische Verbrennungszigaretten und können als Ausstiegs- oder Übergangsprodukte hilfreich sein.
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Popp, PKD und Ordinationszentrum Döbling, Heiligenstädterstr. 46-48; 1190 Wien, wpopp@gmx.at
Präsident des Vereins „Gesundheitskompetenz Austria“
Kurzvideo der Veranstaltung: https://www.billrothhaus.at/index.php?option=com_billrothtv&void=6441&selectedCat=1
Die kompletten Videomitschnitte aller Vorträge können von Mitgliedern der Gesellschaft der Ärzte kostenlos auf www.billrothhaus.at angesehen werden.
Hinweis: Für Studierende ist das erste Jahr der Mitgliedschaft kostenlos. Mehr Info finden Sie hier.