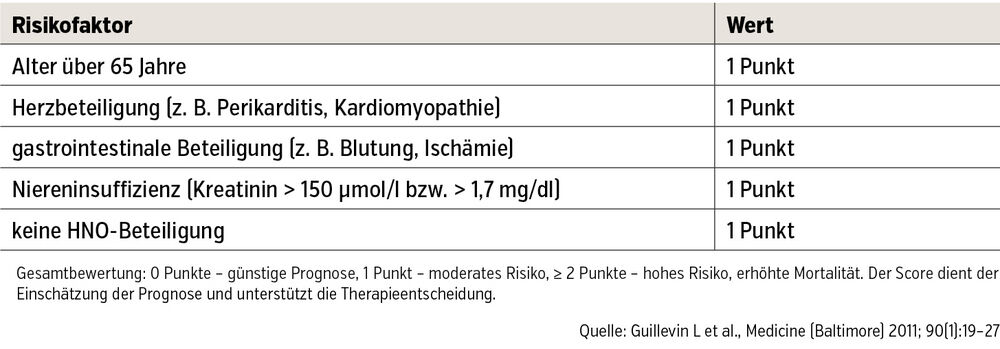Vaskulitis mit vielen Gesichtern
Die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA, früher Churg-Strauss-Syndrom) ist eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der kleine bis mittelgroße Gefäße entzündet sind. Meistens entwickelt sie sich auf dem Boden eines allergischen Asthmas, in Kombination mit einer Eosinophilie – und kann bei verzögerter Diagnostik lebensbedrohlich verlaufen. Für Hausärzt:innen ist die frühe Erkennung entscheidend.
Leitsymptom: persistierende Eosinophilie
Die EGPA geht nahezu immer mit einer Eosinophilie > 1.000/μl einher. Meist bestehen seit Jahren ein allergisches Asthma bronchiale oder eine chronischeRhinosinusitis. Besonders verdächtig ist eine Kombination dieser Symptome mit:
- generalisierten Beschwerden (z. B. Fieber, Gewichtsverlust)
- neu aufgetretenen neurologischen Ausfällen (z. B. Mononeuritis multiplex)
- Hautveränderungen (z. B. palpable Purpura)
- untypischerHerzsymptomatik (z. B. Perikarderguss, Herzinsuffizienz).
Auch eine eosinophile Pneumonie (Milchglastrübungen im CT) oder Gastroenteritis können Manifestationen der Erkrankung sein.
Diagnostik: Der Schlüssel liegt im Muster
Da es keinen spezifischen Einzeltest für EGPA gibt, erfolgt die Diagnose anhand der klinischen Präsentation, Laborwerte und Biopsie. Wichtige Hinweise:
- Blutbild: Eosinophilie, ggf. Anämie, erhöhte IgE, Hypergammaglobulinämie
- ANCA (meist p-ANCA/MPO): bei ca. 40–60 % positiv
- Bildgebung Thorax: Milchglasverschattungen, Knotenbildungen, Kavernen, eosinophilenreiche Pleuraergüsse
- EKG, Echo, ggf. Herz-MRT: eosinophile Entzündung kann sämtliche Teile des Herzens betreffen (Perikarderguss, Klappeninsuffizienz, Herzinsuffizienz etc.)
- Urinstatus, Kreatinin: Hämaturie, Proteinurie, Kreatininerhöhung
- Biopsie: z. B. Haut oder Nerv vor Therapiebeginn (wenn möglich)
Individuelle Therapie nach Schweregrad
Die Behandlung wird in Induktions- und Erhaltungstherapie unterteilt. Zur Einschätzung des individuellen Risikos und der Prognose hat sich der Five Factor Score bewährt (Tab.).
- bei organ- oder lebensbedrohlicher Erkrankung: hochdosierte Glukokortikoide (z. B. Prednisolon 1 mg/kg KG oder i.v. Methylprednisolon) kombiniert mit Cyclophosphamid oder Rituximab
- bei nichtbedrohlichem Verlauf: Kombination aus Glukokortikoiden mit Mepolizumab (Anti-IL-5-Antikörper), Methotrexat, Azathioprin oder Mycophenolat-Mofetil
- Erhaltungstherapie: nach Erreichen der Remission niedrig dosierte Glukokortikoide und ein Immunmodulator (Methotrexat, Azathioprin, Mycophenolat-Mofetil oder Mepolizumab). Die Glukokortikoiddosis sollte schrittweise reduziert (nach 3 Monaten <10 mg Prednisolon/Tag) und möglichst innerhalb eines Jahres ganz ausgeschlichen werden.
- Langzeitmanagement: Eine langfristige Kontrolle dieser Patient:innen inklusive Monitoring der Eosinophilenzahlen ist wichtig, da es nicht selten zu Rückfällen kommt, die eine neuerliche Intensivierung der Therapie notwendig machen.
- Wichtig: Infektionsprophylaxe (z. B. Pneumokokken-, Influenza-, COVID-19-Impfung) sowie Pneumocystis-Prophylaxe bei intensiver Immunsuppression
Drastisch verbesserte Prognose
Mit den heute zur Verfügung stehenden Medikamenten hat sich die Prognose der EGPA dramatisch verbessert. Die ehemals 50%ige Mortalität innerhalb von 3 Monaten hat sich zu einer 70–90%igen 5-Jahres-Überlebensrate entwickelt. Nach wie vor kommt es jedoch leider zu Todesfällen aufgrund von Herzversagen, Hirnblutung, Nierenversagen, gastrointestinalen Blutungen sowie unbeherrschbarem Status asthmaticus.