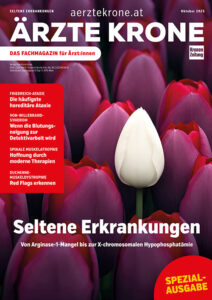Die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist die häufigste Form der Muskeldystrophien im Kindesalter. Aufgrund des X-chromosomal-rezessiven Erbganges tritt die Erkrankung nahezu ausschließlich bei Buben auf; in extrem seltenen Fällen, wenn das 2. X-Chromosom inaktiv ist, können auch Mädchen erkranken. Der Pathomechanismus der DMD beruht auf einem Gendefekt am Dystrophin-Gen, das zu den größten Genen des menschlichen Körpers gehört. Daraus resultiert ein Fehlen des Proteins Dystrophin in der Muskelzellmembran, das für deren Stabilität entscheidend ist. Dystrophin-Mangel führt zu erhöhter Verletzlichkeit der Muskelzelle und damit zu vermehrtem Muskelzelluntergang. Dies wiederum führt zu einer Entzündungsreaktion, die einen fettig-fibrotischen Umbau der Muskulatur bedingt.
Natürlicher Krankheitsverlauf
Die DMD zählt zu den Gliedergürtel-Muskeldystrophien, d. h., die stammnahen Muskeln sind zuerst betroffen. Buben mit DMD kommen scheinbar gesund zur Welt und können sich zunächst auch motorisch völlig unauffällig entwickeln, bis etwa im Kindergartenalter erste Anzeichen einer Muskelschwäche wie abnehmende Geschwindigkeit und Ausdauer beim Laufen oder Stiegensteigen auffallen. Später fällt ein „watschelndes“ Gangbild auf (Trendelenburg-Gangbild), Gehgeschwindigkeit und Ausdauer verschlechtern sich zunehmend bis zum Verlust der Gehfähigkeit in der Volksschulzeit bis frühen Adoleszenzphase. Im weiteren Verlauf tritt eine Schwäche der oberen Extremitäten auf, die letztendlich in einer völligen Immobilität resultiert. Die Jugendlichen sind dann in allen Alltagstätigkeiten auf Hilfe angewiesen, was eine große psychosoziale Belastung bedeutet. Im fortgeschrittenen Stadium führt die Beteiligung der Atemmuskulatur zu einer Einschränkung der Lungenfunktion mit Husteninsuffizienz, wodurch respiratorische Infektionen schwerer verlaufen. Die Herzbeteiligung, deren Beginn und Ausmaß sehr variabel sind, verursacht Herzinsuffizienz und Arrhythmien. Aufgrund des guten respiratorischen Managements mit Hustenunterstützung und Heimbeatmung ist das Herzversagen mittlerweile die häufigste Todesursache.
Erstmanifestationen und Red Flags
Erste Anzeichen von DMD können sich bereits im Kleinkindalter zeigen (z.B. später Gehbeginn, Neigung zum Zehenballengang, häufiges Stolpern), später kommen Verminderung von Geschwindigkeit und Ausdauer, Veränderung des Gangbildes und Probleme beim Aufstehen vom Boden („Gowers-Zeichen“) hinzu. Bei einem relevanten Teil der Betroffenen bestehen Auffälligkeiten beim Lernen und im Verhalten, wie eine Sprachentwicklungsverzögerung, die häufig die erste Auffälligkeit darstellt. Circa 30 % haben eine kognitive Beeinträchtigung. Die Entwicklung kann im Kleinkindalter aber auch völlig unauffällig sein. Die wichtigsten Red Flags umfassen eine verzögerte motorische oder sprachliche Entwicklung, Zehenspitzengang sowie eine symmetrische Muskelschwäche (Gowers-Zeichen). Ein weiteres Alarmsignal sind muskulöse, starke Waden („Sportlerwaden“), die durch den Umbau des Muskels in Bindegewebe entstehen.
Diagnosepfad
Bei Sprachentwicklungsverzögerung, verzögertem Gehbeginn oder Hinweisen auf Muskelschwäche sollte im Labor die Kreatinkinase (CK) abgeklärt werden, die bei DMD etwa 10–100-fach erhöht ist – ist diese normal, kann DMD ausgeschlossen werden. Erhöhte Transaminasen (ASAT, ALAT) sind nicht leberspezifisch, sondern regelhaft bei erhöhter CK anzutreffen. Durch Abklärung zufällig gefundener erhöhter Leberwerte gelingt immer wieder eine frühe Diagnose der DMD.
Liegt eine Muskelschwäche und/oder eine CK-Erhöhung vor, ist der Patient an ein neuropädiatrisches Zentrum zu überweisen, wo die genetische Diagnostik erfolgt. Nur noch in sehr wenigen Fällen, in denen die genetische Veränderung nicht mit genetischen Methoden gefunden wird, kann eine Muskelbiopsie erforderlich sein. Es ist vorteilhaft, bereits EKG und Herzecho aus dem niedergelassenen Bereich zur Erstvorstellung mitzubringen.
Differenzialdiagnostische Abgrenzung
Zu den wichtigsten Differenzialdiagnosen zählen die Becker-Muskeldystrophie (BMD), die große Zahl an unterschiedlichen Gliedergürtelmuskeldystrophien (LGMD) sowie die spinale Muskelatrophie (SMA). Bei der BMD handelt es sich um eine mildere Form der Dystrophinopathie. Hier treten Symptome erst später auf, und die Prognose ist günstiger als bei der DMD. Die milden Formen der SMA weisen anfangs ein gleiches Verteilungsmuster der Schwäche auf, zeigen aber keine oder nur eine sehr milde CK-Erhöhung. Die frühe Diagnose der SMA ist von höchster Priorität, da ihr Fortschreiten durch genmodifizierende Behandlungsmöglichkeiten gestoppt werden kann.
Therapie der DMD
Ein frühzeitiger Behandlungsbeginn ist entscheidend, um die Muskelkraft möglichst lange zu erhalten und damit den Gehverlust hinauszuzögern. Die aktuell verfügbaren Therapien tragen dazu bei, dass die mit dem Muskelzelluntergang einhergehenden entzündlichen und fibrosierenden Prozesse hintangehalten werden. Deshalb gehören Kortikosteroide bereits seit Jahrzehnten zu den etablierten Behandlungsstandards. Um die nachteilige Wirkung der Langzeitbehandlung auf Wachstum und Knochen zu reduzieren, wurde das synthetische dissoziative Kortikosteroid Vamorolon entwickelt, das seit Ende 2023 von der EMA zugelassen ist. Im Juli 2025 erhielt der Histon-Deacetylase-(HDAC-)Inhibitor Givinostat ebenfalls die Zulassung in Europa für gehfähige Patienten ab 6 Jahren in Kombination mit einer Kortikosteroidtherapie. Auch diese Substanz zielt auf eine Reduktion des fibrotischen Muskelumbaus und kann unabhängig vom genetischen Hintergrund der Erkrankung eingesetzt werden. Sie benötigt initial ein engmaschiges Monitoring möglicher Nebenwirkungen mit Laborkontrollen (Thrombozytenzahl, Blutfette) und EKG (cQT-Zeit).
Darüber hinaus befinden sich genbasierte Therapien in klinischer Entwicklung, die darauf abzielen, den defekten Teil des Gens zu überspringen (Exon-Skipping) oder ein funktionierendes Gen in die Muskelzelle einzuschleusen. Da das Dystrophin-Gen aber zu groß für Virusvektoren ist, kann lediglich ein Mikrodystrophin verwendet werden, das ein kürzeres und nicht ganz so funktionstüchtiges Dystrophin produziert wie das intakte Gen. Da die Muskulatur ein regenerierendes Gewebe ist, die Gentherapie aber aufgrund der Immunität nur einmalig mit einem Virusvektor angewendet werden kann, ist auch mit einer nachlassenden Langzeitwirkung zu rechnen. Die aus den Medien bekannten Erfolge der genmodifizierenden Therapien der SMA werden mit den genbasierten Ansätzen, die bei DMD in klinischer Erprobung sind, nicht erreicht werden können. Unabhängig von den Therapien, die darauf abzielen, den Krankheitsverlauf zu verzögern, haben in den letzten Jahren die Standards of Care zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität und Verlängerung der Lebenserwartung geführt. Früher verstarben die Patienten im späten Jugend- bzw. frühen Erwachsenenalter am Atemversagen. Frühe Maßnahmen zur Lungenvolumenrekrutierung und Hustenunterstützung ab dem Jugendalter sowie die nichtinvasive Heimbeatmung – initial nur nachts über Maske, später auch tagsüber mittels Mundstück – helfen, die Lungengesundheit zu erhalten. Mittlerweile liegt die Lebenserwartung dadurch bei 30–40 Jahren, zum Teil auch darüber. Die Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen bedarf eines multidisziplinären Managements, in das je nach Krankheitsstadium zahlreiche medizinische Spezialisierungen und therapeutische und psychosoziale Berufsgruppen involviert sind. Vorausschauende und vorbereitende Gespräche helfen den Familien, sich rechtzeitig auf die nächste Krankheitsphase vorzubereiten und die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen einzuleiten. So können der Krankheitsverlauf verlangsamt, Folgeprobleme der Muskelschwäche bzw. Immobilität reduziert und entwicklungsgerechte soziale Teilhabe verbessert werden. Aus diesem Grund ist auch bei noch fehlenden kurativen Behandlungsmöglichkeiten eine frühe Diagnose entscheidend.