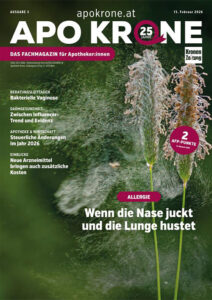Nebenwirkungen managen, Lebensqualität erhalten
Opioide sind Analgetika der WHO-Stufen II und III mit breitem Wirkungsspektrum, die eine Vielzahl von Organsystemen und eine große Anzahl von Körperfunktionen beeinflussen. Während ihre Langzeitanwendung bei nichttumorbedingten chronischen Schmerzen umstritten ist, gilt ihr Nutzen bei tumorbedingten Schmerzen als gut belegt. In der Onkologie steht die ausreichende Analgesie im Vordergrund; dennoch sollten auch hier Nebenwirkungen sorgfältig beobachtet und frühzeitig behandelt werden, um eine optimale Schmerztherapie zu gewährleisten.
Verstopfung und Übelkeit, die häufigsten Nebenwirkungen, können oft sehr belastend sein. Obstipation kann so schwerwiegend sein, dass ein Absetzen bzw. eine Rotation des Opioids erforderlich ist, und zu Unterdosierung sowie unzureichender Analgesie beitragen. Eine Rotation des Opioids und/oder der Verabreichungsart kann Nebenwirkungen minimieren. Deswegen sind vor einer Opioideinstellung eine ordnungsgemäße Anamnese, Krankenuntersuchung, Aufklärung und präventive Behandlung potenzieller Nebenwirkungen unbedingt durchzuführen. So wird die Wirksamkeit erhöht und gleichzeitig die Schwere der Nebenwirkungen und unerwünschten Ereignisse verringert.
Management der Nausea und Emesis
Übelkeit und Erbrechen treten besonders häufig in der Initialphase der Opioidtherapie bei Krebspatient:innen auf. Daran sind mehrere Mechanismen beteiligt, darunter die Stimulation zentraler und peripherer Strukturen wie des Brechzentrums, der Chemorezeptor-Triggerzonen (CTZ), des vestibulären Apparates und des Gastrointestinaltraktes.Die Behandlung erfolgt symptomorientiert. Dopamin-Rezeptorantagonisten (z. B. Haloperidol, Metoclopramid) gelten als bewährte Erstlinientherapie, wobei Metoclopramid zusätzlich durch seine prokinetische Wirkung bei gleichzeitiger Obstipation vorteilhaft ist. Serotoninrezeptorantagonisten (z. B. Ondansetron) zeigen insbesondere bei Übelkeit durch CTZ-Stimulation gute Wirksamkeit und Verträglichkeit.
Histaminantagonisten (z. B. Cyclizin) oder Anticholinergika (z. B. Scopolamin) kommen ergänzend in Betracht, insbesondere bei Schwindel oder bewegungsassoziierter Übelkeit. Bei persistierenden Symptomen kann eine Kombination verschiedener Antiemetika notwendig sein.
In der onkologischen Praxis ist es zudem wichtig, andere Ursachen – etwa Chemotherapie, gastrointestinale Obstruktion oder Hirnmetastasen – differenzialdiagnostisch zu berücksichtigen. Wenn die Übelkeit klar opioidinduziert ist, kann auch eine Rotation auf ein anderes Opioid oder eine Änderung der Applikationsform hilfreich sein. Bei therapierefraktären Fällen sind Dronabinoltropfen eine mögliche Ergänzung.
Management der Obstipation
Verstopfung tritt bei bis zu 95 % der mit Opioiden behandelten Tumorpatient:innen auf und zählt zu den belastendsten Nebenwirkungen der Tumorschmerztherapie. Langfristige Folgen können zu erheblicher Morbidität sowie Mortalität führen und sich negativ auf die Lebensqualität auswirken. Schwere Obstipation kann Patient:innen dazu zwingen, die Opioiddosis zu reduzieren, was zu einer verminderten Analgesie führt. Chronische Verstopfung kann zu Hämorrhoidenbildung, Schmerzen und Brennen im Rektum, Ileus sowie möglicherweise zu Darmrupturen und Tod führen.
Opioide aktivieren sowohl über eine vaskuläre Verteilung als auch bei lokaler Anwendung im Darm µ-Rezeptoren im Gastrointestinaltrakt, die für die Darmmotilität verantwortlich sind. Loperamid, ein Opioidrezeptoragonist mit eingeschränkter Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, wird klinisch zur Behandlung von Durchfall eingesetzt, was darauf hindeutet, dass Opioide eine direktere lokale Verstopfungswirkung haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Opioidnebenwirkungen entwickelt sich bei der Verstopfung keine Toleranz, sie muss daher während der gesamten Behandlungsdauer überwacht werden.
Die Obstipation wird teilweise durch die Verwendung verschiedener Arten von Opioidverbindungen oder Verabreichungswegen oder die Kombination von Opioiden mit anderen Medikamenten gemildert. Zusätzliche Prävention mit spaltbaren/löslichen Ballaststoffen kann die Entstehung einer Obstipation positiv beeinflussen sowie den Bedarf an Laxanzien reduzieren. Bewegung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und ballaststoffreiche Ernährung können unterstützend wirken, sind bei fortgeschrittenen Tumorpatient:innen jedoch häufig nur eingeschränkt umsetzbar. Opioidantagonisten können in dieser Hinsicht eine wichtige therapeutische Rolle spielen. Die Antagonisierung der gastrointestinalen μ-Rezeptoren ist die Grundlage vieler Medikamente zur Behandlung der opioidbedingten Verstopfung (z. B. Naloxegol, Methylnaltrexon). Sie blockieren die peripheren Wirkungen von Opioiden, während zentrale analgetische Effekte ausgespart werden, und kehren die darmverlangsamende Wirkung um. Opioidaintagonisten stellen somit eine wichtige Ergänzung im Management der opioidinduzierten Obstipation dar.
Prinzipiell ist anzuraten, mit Beginn einer Opiodtherapie ein Laxans als Begleitmedikation zu verschreiben. Unter den konventionellen Laxanzien sollten Macrogol (Polyethylenglykol), Bisacodyl, Natriumpicosulfat und Sennapräparate als Arzneimittel der ersten Wahl zum Einsatz gelangen. Bei individuell nachgewiesener guter Wirksamkeit ist eine Begrenzung des Einnahmezeitraums von Macrogol unbegründet. Ihre Wirkung entfalten diese Arzneimittel in der Regel entweder über eine Erhöhung des Wassergehaltes des Darminhaltes oder als osmotische Quellstoffe, die über die dadurch bedingte Verflüssigung des Stuhls und die hiermit einhergehende Volumenzunahme sekundär Darmwanddehnungen auslösen, die reflektorisch zu einer Erhöhung peristaltischer Kontraktionen führen.
Resümee
In der Behandlung tumorbedingter Schmerzen sind Opioide unverzichtbar. Ihr Nutzen überwiegt die Risiken deutlich – vorausgesetzt, Nebenwirkungen werden konsequent überwacht und frühzeitig adressiert. Ein strukturiertes Nebenwirkungsmanagement mit prophylaktischen Maßnahmen, individueller Dosisanpassung und gegebenenfalls Opioidrotation trägt wesentlich zur Therapietreue und Lebensqualität onkologischer Patient:innen bei.