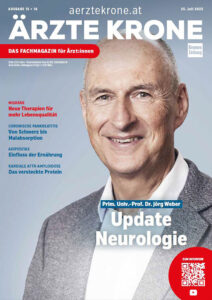Der Mythos, dass die Harnblase ein steriles Organ ist, wurde schon lange widerlegt. Der gesamte Urogenitaltrakt ist von einer Vielzahl an Mikroorganismen besiedelt, die im Harntrakt das Urobiom bilden. Die Identifizierung der kommensalen Bakterien wurde in den letzten Jahren dank moderner Techniken wie der 16S-rRNA-Sequenzierung rasant vorangetrieben, womit neue Erkenntnisse über die Gesundheit der Harnwege und die Entstehung von Infektionen geschaffen wurden.1
Zusammensetzung des gesunden Urobioms
Es gibt nicht „das eine gesunde Mikrobiom“. Die Besiedelung durch Bakterien, eukaryotische Viren, Protozoen und Pilze unterscheidet sich individuell je nach Alter, Geschlecht, Lebensstil und Umwelteinflüssen. Die gesunde Besiedlung des Harns setzt sich aus über 100 Mikroorganismen zusammen, vorrangig sind Laktobazillen, Corynebakterien, Streptokokken, Veillonella und Prevotella. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind zum einen die hauptsächlich männliche Besiedlung von Corynebakterien und Streptokokken und zum anderen die vorrangig weibliche Besiedlung von Laktobazillen sowie eine größere Vielfalt des weiblichen Mikrobioms.2 Die Bandbreite der vorhandenen Mikroben nimmt mit dem Alter ab, wobei ab dem 70. Lebensjahr vermehrt die Bakterienarten Jonquetella, Parvimonas, Proteiniphilum und Saccharofermentans vorzufinden sind.3 Eine Dysbalance des natürlichen Urobioms kann unter anderem zu der häufig vorkommenden Harnwegsinfektion (HWI) führen.1 Solche Dysbiosen werden durch eine oder mehrere der folgenden Kriterien charakterisiert: eine Zunahme pathogener Mikroorganismen, eine Abnahme kommensaler Mikroorganismen und eine Verringerung der mikrobiellen Vielfalt.3 Der prädominante HWI-auslösende Erreger ist E. coli, weshalb standardmäßige, zur Diagnose verwendete Harnkulturen auf gramnegative Bakterien spezialisiert und durch andere Mikroben ausgelöste Dysbiosen unterdiagnostiziert sind.4, 5
Präzisere Diagnostik
Durch das bloße Anlegen der Harnkulturen von Patient:innen mit und ohne HWI-Symptome wurden Studien zufolge 67% der identifizierten Uropathogene und 88% der Nicht-E.-coli-Uropathogene, einschließlich Hefen, grampositiver Bakterien, anaerober Bakterien und anspruchsvoller Bakterien, nicht registriert. Die Anwendung der erweiterten quantitativen Harnkultur schnitt in dieser Hinsicht besser ab, ist jedoch zu aufwändig, um in der klinischen Routinepraxis eingesetzt zu werden. Eine weitere Möglichkeit bietet die empfindliche und spezifische Multiplex-PCR, wobei ein breites Spektrum an Sonden und Primern bekannter und potenzieller Uropathogene einbezogen werden sollte, um grampositive sowie -negative Bakterien, anspruchsvolle Mikroorganismen und Viren zu entdecken. Zusätzlich sollten Multiplex-PCR-Tests zum Nachweis von Antibiotikaresistenzgenen entwickelt werden, um Informationen über die Antibiotikaempfindlichkeit der Erreger zu erhalten.5
HWI vs. asymptomatische Bakteriurie
Beim Vorhandensein pathogener Bakterien im Harntrakt ohne die Ausbildung von HWI-typischen Symptomen spricht man von einer asymptomatischen Bakteriurie. In diesem Fall ist bei Nichtrisikopatient:innen keine Antibiotikatherapie notwendig.7 Eine Ausnahme besteht etwa bei schwangeren Frauen. In diesen Fällen kann eine Behandlung die Ausbildung einer Pyelonephritis, eine frühzeitige Geburt und/oder ein Untergewicht des Neugeborenen verhindern.5
Interaktionen des Urobioms
Zandbergen et al. haben untersucht, wie sich kommensale und uropathogene Bakterien aufeinander auswirken. Bakterien aus dem Harn von Patient:innen mit einem HWI und Bakterien aus dem Harn asymptomatischer Personen wurden isoliert, und Wechselwirkungen wurden beobachtet. Pathogene Bakterien haben dabei das Wachstum der natürlich vorkommenden Bakterien stärker gehemmt als umgekehrt. Diesen Ansatz gilt es weiter zu untersuchen, um die Entstehung und Vermeidung von symptomatischen Infektionen besser verstehen zu können.2 Eine weitere Studie von Adu-Oppong et al. hat sich mit Überschneidungen von symptomatischen und asymptomatischen Zuständen der Mikrobiota des Urogenitaltraktes beschäftigt und gibt Hinweise darauf, dass nicht das bloße Vorliegen von Bakterien, sondern vielmehr die individuelle Immunantwort klinische Symptome hervorruft. Diese Erkenntnisse heben hervor, wie wichtig die Analyse des Urobioms HWI-erkrankter Patient:innen für eine nachhaltige Behandlung ist.6
Therapeutische Ansätze zur Behandlung urogenitaler Erkrankungen
Die bei HWI standardmäßig eingesetzten Antibiotika zeigen sich effektiv im Kampf gegen Erreger, führen jedoch auch zu einer Dysbiose des Urobioms. Vor allem Laktobazillen zeigen einen Rückgang nach einer Antibiotikatherapie, was einen rezidiven Infekt sowie bakterielle Vaginosen begünstigt.3, 4 Antivirale und antibakterielle sowie harntreibende Wirkstoffe aus pflanzlichen Arzneidrogen können als schonendere Behandlungsalternative erwogen werden. Präparate mit Kapuzinerkressekraut, Meerrettichwurzel, Birkenblättern, Bärentraubenblättern, Löwenzahnwurzel, Liebstöckelwurzel, Rosmarinblättern und Tausendgüldenkraut werden beispielsweise bereits in der aktuellen S3-Leitlinie zur unterstützenden Behandlung eines HWI sowie zur Prophylaxe von Rezidivinfekten genannt.7
Fazit
HWI zählen zu den häufigsten Infektionen weltweit und betreffen etwa 60 % der Frauen mindestens einmal in ihrem Leben. Neue Technologien gewähren Aufschluss über das gesunde Mikrobiom und eröffnen erfolgversprechendere Diagnoseverfahren für eine gezieltere Therapie, um den Antibiotikagebrauch und die Bildung von Antibiotikaresistenzen zu reduzieren.