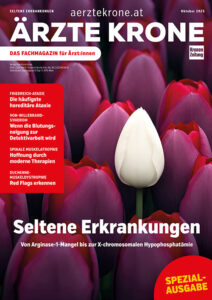Die ersten Anzeichen sind Gang- und Gleichgewichtsstörungen, eine ausgeprägte Ungeschicklichkeit, in der Schule Schreibprobleme mit unleserlicher Schrift bzw. Koordinationsstörungen beim Turnen, oft auch Sprechstörungen mit undeutlicher Aussprache, in seltenen Fällen auch orthopädische Symptome wie Skoliose und Hohlfuß oder auch Herzprobleme. Eine Skoliose ist oftmals schon bei Diagnosestellung vorhanden und schreitet in der Adoleszenz weiter fort.
Diagnostikpfad
In der Regel wird die Verdachtsdiagnose im Kindes- bzw. Jugendalter anhand der klinischen Symptome gestellt. Die initialen Symptome umfassen eine progrediente Gangataxie, Dysarthrie, zunehmende Dysdiadochokinese, Muskelhypotonie sowie Areflexie der unteren Extremitäten. Im Verlauf kommt es regelmäßig zu einer ausgeprägten Standataxie mit Sturzneigung, häufig zur Rollstuhlpflichtigkeit innerhalb von ein bis zwei Dekaden nach Symptombeginn.
Die Diagnose wird durch einen gezielten Gentest, der die GAA-Triplettverlängerung auf beiden Allelen des FXN-Gens nachweist, gesichert.
Als ergänzende Untersuchungen sollten neurophysiologische Untersuchungen durchgeführt und ein MRT von Rückenmark und Gehirn angefertigt werden. Der MRT-Befund eignet sich insbesondere, um Differenzialdiagnosen auszuschließen, denn eine Kleinhirnatrophie, die schon im Frühstadium vorliegt, lässt eher auf andere Ataxieformen schließen. Damit die Patient:innen Zugang zu allen verfügbaren Therapieoptionen erhalten und ihre Bedürfnisse individuell berücksichtigt werden, sollten sie möglichst frühzeitig nach oder zur Diagnosesicherung an ein spezialisiertes Zentrum überwiesen werden.
Differenzialdiagnostische Abgrenzung
Differenzialdiagnostisch kommen vor allem andere hereditäre Ataxien, aber auch mit metabolischen Erkrankungen sowie mit toxischen oder autoimmun bedingten ZNS-Schädigungen assoziierte Ataxien in Betracht. Eine Friedreich-Ataxie ist unwahrscheinlich, wenn frühzeitig eine Kleinhirnatrophie besteht oder die Patient:innen kognitive Einschränkungen aufweisen.
Therapie
Behandlung neurologischer Symptome: Eine kontinuierliche neurorehabilitative Therapie (Physio-, Ergo- und Logopädie) sollte mehrmals pro Woche stattfinden. Der Fokus sollte hierbei neben der Verständlichkeit des Sprechens auf Koordination und Kräftigung der unteren Extremitäten liegen, um die Gehfähigkeit der Patient:innen zu erhalten. Bei rollstuhlpflichtigen Patient:innen ist die Therapie der oberen Extremitäten von entscheidender Bedeutung.
Spastizität kann medikamentös, z. B. mit Baclofen, Botulinumtoxin oder Tizanidin, behandelt werden, wenn die physiotherapeutischen Maßnahmen nicht ausreichen. Gegen neuropathische Schmerzen können Gabapentin oder Pregabalin helfen. Medikamente gegen Dranginkontinenz können die Überaktivität der Blase reduzieren.
Behandlung nichtneurologischer Symptome: Kardiologische Verlaufskontrollen sollten einmal jährlich erfolgen (inkl. TTE, EKG und eventuell 24-Stunden-EKG), um Herzrhythmusstörungen oder eine Kardiomyopathie frühzeitig zu erkennen. Auf das frühe Erkennen eines Diabetes mellitus sollte durch ein mindestens 1-mal jährliches Screening geachtet werden. Die Behandlung dieser nichtneurologischen Manifestationen erfolgt dann nach allgemein gültigen Behandlungsleitlinien für die jeweiligen Zusatzsymptome. Bei schwerer Skoliose oder Hohlfüßen kann unter Berücksichtigung des Mobilitätsstatus eine operative Versorgung angedacht werden.
In Entwicklung befindliche Medikamente mit kausaler Intention: Basierend auf der Pathophysiologie der Friedreich-Ataxie sind grundsätzlich 4 verschiedene Therapieansätze möglich:
- Gentherapie bzw. „gennahe Therapie“ zur Beeinflussung der GAA-Repeat-Expansion (z. B. AAV-Vektortherapie, „small molecules“, Antisense-Oligonukleotide, sog. ASO)
- Modulation der abnormen DNA-Konfiguration (z. B. Histondeacetylase-Inhibitoren) und dadurch konsekutive Steigerung der mRNA-Expression von Frataxin
- Erhöhung der Frataxin-Konzentration durch externe Zufuhr des Proteins Frataxin (z. B. mittels Vektoren) bzw. Hemmung des Abbaus von Frataxin
- Verbesserung der mitochondrialen Funktion durch Antioxidanzien und Vitamin-Supplementation bzw. über die Beeinflussung des Eisenstoffwechsels
Sämtliche Kandidatensubstanzen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen sind derzeit bei der Friedreich-Ataxie in Entwicklung bzw. bereits in klinischer Testung. Vielversprechende Ansätze wie eine vektorbasierte Gentherapie zur Behandlung der Kardiomyopathie bei der Friedreich-Ataxie sind allerdings ebenso wie Methoden zur Zufuhr von synthetischem Frataxin (TAT-Frataxin) noch in früheren Entwicklungsphasen. Abgeschlossene oder laufende Phase-III-Studien (Zulassungsstudien) setzen vor allem am Ende der pathophysiologischen Kaskade an und bedienen die mitochondriale Funktionsstörung. Diesbezüglich ist eine Phase-III-Studie, auch an pädiatrischen Patient:innen, mit Vatiquinon gerade abgeschlossen worden.
Omaveloxolon als erste zugelassene Therapie: Omaveloxolon ist seit Februar 2024 in der EU für die Therapie der Friedreich-Ataxie ab 16 Jahren zugelassen. Omaveloxolon steigert NRf2 (Nuclear Factor Erythroid-2-related Factor 2), das wiederum über sogenannte „anti responsive elements“ die Transkription antioxidativer Gene anregt und so zu vermindertem oxidativem Stress und zu einer Verbesserung der mitochondrialen Funktion führt. In einer kontrollierten, randomisierten Studie über 48 Wochen mit Einnahme von 150 mg/d oral zeigte sich ein signifikanter Unterschied im mFARS-Score (modifizierte Friedreich Ataxia Rating Scale) von knapp 2,5 Punkten im Vergleich zu Placebo. Daten aus der offenen Extensionsphase unterstützen diese Ergebnisse, vor allem durch Vergleiche (Propensity Matching) mit Registerdaten zum natürlichen Krankheitsverlauf der Friedreich-Ataxie. Eine Studie an pädiatrischen Friedreich-Ataxie-Patient:innen läuft aktuell und ist auch in Österreich in Planung.