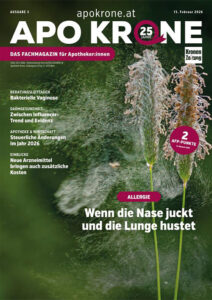Digitale Transformation in der Primärversorgung
Unter dem Motto „Digitale Transformation in der Primärversorgung“ bot die Veranstaltung Einblick und Ausblick zur Digitalisierung im Gesundheitswesen, so auch für Österreich: Das oberste Ziel der Gesundheitsreform Ende 2023 lautete, die medizinische Versorgung für alle Menschen in Österreich in hoher Qualität zu sichern. Der Grundsatz „digital vor ambulant vor stationär“ soll u.a. dazu beitragen, soziale und medizinische Ungleichgewichte gering zu halten. Ein paar Beispiele sind bereits Standard und Beleg dafür, dass Digitalisierung dazu beiträgt, die Effizienz und Qualität im Gesundheits- und Pflegebereich zu verbessern, wie etwa das e-Rezept oder das Impfregister/der e-Impfpass. Profitieren von der Digitalisierung sollen sowohl die Patient:innen als auch die sogenannten GDA (Gesundheitsdiensteanbieter – an dieses Wort muss man sich leider gewöhnen).
Großes Potenzial
Im Vorjahr wurde eine eHealth-Strategie mit einem Zeithorizont bis 2030 erarbeitet, seither werden in Österreich jährlich 51 Mio. Euro für eine Forcierung der Digitalisierung im Gesundheitssystem investiert. Damit stehen wir im internationalen Vergleich gut, jedoch nicht sehr gut da, denn hohe Kosten für Spitäler stehen nach wie vor vergleichsweise geringen Ausgaben für den niedergelassenen Bereich, Digitalisierung und Vorsorge gegenüber. Überdurchschnittlich hoch ist zudem der Anteil an Gesundheitsausgaben, die von Patient:innen privat bezahlt werden. Durch die Bemühungen von vielen Seiten werden wir in den nächsten Jahren viele Änderungen erleben. Die Investitionen führen natürlich zu neuen Entwicklungen, für die Umsetzung in die alltägliche Praxis erscheint es da aber auch gut, von Anfang an dabei zu sein, statt die Augen zu verschließen und das alles über sich ergehen zu lassen. Aus meiner Sicht haben die Digitalisierung und die Telemedizin das Potenzial, auch in der Primärversorgung viel zum Positiven zu verändern, z.B.
- bessere Erreichbarkeit vor allem im ländlichen Raum oder für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- Effizienzsteigerung durch Erleichterung von Routinearbeiten und dadurch Zeitersparnis
- bessere Kontinuität und Koordination der Versorgung durch elektronische Vernetzung der GDA, z.B. allein schon durch die Möglichkeit einer einheitlichen Codierung und damit verbesserten Interoperabilität – ein Projekt, dessen Grundsteine mitunter durch Mitglieder der ÖGAM und Karl Landsteiner Privatuniversität Krems gelegt wurden
- Steigerung der diagnostischen und therapeutischen Qualität mit Hilfe der künstlichen Intelligenz – sofern diese richtig genutzt wird
- Prävention und Gesundheitskompetenz können durch digitale Tools und Apps angehoben werden.
Kooperation
Aktuell gibt es in Österreich knapp über 100 PVE, davon 14 Kinder-PVE. Laut ÖGK und Plattform Primärversorgung werden etwa 10% der Bevölkerung versorgt. Bis zum Jahr 2030 wird das Ziel von 300 PVE in Österreich angestrebt, diese sollten dann in etwa 30% der Bevölkerung in der Primärversorgung betreuen, 70% der Menschen werden in der Versorgung von Einzel- oder Gruppenpraxen bleiben. Eine Vision von ÖGK-Obmann Andreas Huss – in seiner Ansprache im Rahmen des PV-Kongresses erläutert – ist die Errichtung von Pflege- und Therapiepraxen in Zusammenarbeit mit Hausärzt:innen in der Einzel- bzw. Gruppenpraxis, nachdem die Entwicklung von PVN (also Primärversorgungsnetzwerken) im Gegensatz zu PVZ (Primärversorgungszentren) kaum in die Gänge kommt. Aus meiner Sicht könnten diese Pflege- und Therapiepraxen ein ergänzendes Angebot darstellen und manch Ungleichgewicht in der Patientenversorgung ausgleichen, jedoch benötigen diese Ideen sorgsame Entwicklung und klare Konzepte für Patientenwege und Kommunikation, damit sie die (hausärztliche) Primärversorgung nicht weiter fragmentieren, sondern tatsächlich stärken bzw. entlasten.
Vernetzung
Nach dem Grundsatz „digital vor ambulant vor stationär“ werden durch die Gesundheitsreform digitale Angebote für Patient:innen ausgebaut, der niedergelassene Bereich gestärkt und Strukturreformen zur Entlastung der Spitäler umgesetzt – ähnliche Schlagworte haben länger im Gesundheitssystem tätige Ärzt:innen schon oftmals vernommen, allerdings war der Druck auch noch nie so hoch wie jetzt.
Durch die Weiterentwicklung des zentralen Zugangsportals www.gesundheit.gv.at soll die Gesundheitskompetenz der Menschen gestärkt und die Gesundheitsberatung 1450 noch deutlich mehr in ihren Köpfen verankert werden. Das wird für die in der PV tätigen Ärzt:innen einen gewissen Patientendruck reduzieren, was ja positiv ist. Allerdings werden durch diese Maßnahmen „einfache Patientenfälle“ abgehandelt, und die Primärversorger werden einen höheren Anteil an „komplexen Patientenfällen“ zu stemmen haben – vor allem dann, wenn die am Kongress vorgestellten Ziele von 1450 Realität werden: ELGA-Integration, Telemedizin (Videokonsultation) inklusive virtueller Krankenbehandlung und Krankmeldung (Krankmeldung ohne Anwesenheit der Patient:innen wurde uns Hausärzt:innen ja mit Ausnahme der Corona-Zeit verboten) oder Terminservice mit Einbindung in die Arzt-Software (Pilotprojekte diesbezüglich existieren bereits).
Telemedizin
In einer ganz anderen Liga verglichen mit 1450 spielt z. B. die am Kongress vorgestellte, zur Otto-Gruppe gehörende Schweizer Firma Medgate, die auch in Deutschland sehr stark vertreten ist: Knapp 700 Mitarbeiter:innen – davon 180 Ärzt:innen – bieten telemedizinische Dienstleistungen 24 Stunden am Tag ganzjährig an. Die Qualität scheint durch eigene telemedizinische Ausbildung sowie Guidelines hoch zu sein. Über 4.000 Patientenkontakte pro Tag, ein dichtes Netz an Partnerapotheken und – wegen einer Kostenersparnis von 20–30 % pro Patient:in (so die Aussage des Referenten Jörg Weise) – Verträge mit den Krankenkassen machen den niedergelassenen Allgemeinmediziner:innen deutliche Konkurrenz. Gleichzeitig haben gewisse Regionen Deutschlands (z. B. Mecklenburg-Vorpommern) einen so starken Hausarztmangel, dass Telemedizin und somit starke Firmen wie Medgate – neben anderen Maßnahmen – unabdingbar zu sein scheinen.
Beispiel Dänemark
Der Allgemeinmediziner Klaus Höfle berichtete über eHealth in dänischen Hausarztpraxen: Dänemark ist ein Vorreiter bei der digitalen Transformation des Gesundheitswesens, bei dem die Hausarztpraxis eine zentrale Rolle im elektronischen Gesundheitsnetzwerk spielt. Die Kommunikationsplattform ist hierbei das nationale Patientenportal sundhed.dk – vergleichbar mit unserer ELGA. Hier werden neben Gesundheitsdaten, Krankengeschichten und Medikamenten auch Termine verwaltet, oder es können z. B. Patient:innen eigene Vitaldaten eingeben oder Patientenverfügungen aktualisieren. 97% aller Überweisungen geschehen elektronisch, digitale Prozesse steigern die Effizienz. Insgesamt – so Dr. Höfle – trägt die Digitalisierung zur Reduzierung von Krankenhausaufenthalten und zur Verbesserung der medizinischen Versorgung bei.
ELGA
Wieder zurück nach Österreich: ELGA (elektronische Gesundheitsakte) ist bekannterweise bei uns die zentrale Plattform zum Austausch von Daten zur ungerichteten Kommunikation – aktuell können Ärzt:innen (sowie Krankenanstalten, Pflegeeinrichtungen und Apotheken) nach Stecken der e-card 90 Tage lang Befunde von Labor, Radiologie, Krankenhausambulanzen und -stationen sowie die Medikation und Impfpass einsehen. Circa 3% der Pflichtversicherten (etwa 280.000 Österreicher:innen) haben Opt-out gewählt – bei diesen Patient:innen ist einzig der e-Impfpass einsehbar.
Aktuell wird an mehreren Projekten gearbeitet, etwa dem digitalen Medikationsplan namens „DigiMed“, der einen genaueren Überblick über die tatsächliche Medikation eines/einer Patient:in bieten soll – inklusive Dosierung und Einnahmezeiten. Dies soll auch die Grundlage für die spätere Patient Summary sein, einer Zusammenfassung der wichtigsten Gesundheitsdaten einer Person auf einen Blick – aus meiner Sicht das entscheidende Angebot für die Zukunft; derzeit sind die Befunde und die Medikamente leider noch recht unübersichtlich aneinandergereiht, was bei nun steter Zunahme der Daten immer mehr zum Problem wird. Das Einsehen von Bilddaten ist derzeit im Pilotbetrieb. Zusätzlich sollen mobile Pflegedienste an ELGA angebunden werden. In Arbeit ist schließlich auch noch die Anbindung an den europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS). Außerdem möchte man eine sichere, gerichtete Kommunikationsplattform für Gesundheitseinrichtungen nach dem Kommunikationsprotokoll Matrix – als Ersatz für die obsoleten Fax-Sendungen – etablieren.
DiGA
DiGA (digitale Gesundheitsanwendungen) sind in Deutschland seit 2020 im Einsatz – als Apps oder in Form von Webanwendungen. Aktuell gibt es 57 digitale Anwendungen, die Hälfte davon als Unterstützung bei psychischen Erkrankungen. Um als DiGA anerkannt zu werden, muss ein strenges Bewilligungsverfahren (durch das BfArM Deutschland – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) durchlaufen werden, und selbst nach Bewilligung können DiGA bei fehlendem Beleg von positiven Versorgungseffekten wieder gestrichen werden – bislang waren in Deutschland 15 davon betroffen. Verordnet werden die DiGA in Deutschland wie ein Rezept, die Patient:innen bekommen dann einen Freischaltcode für eine gewisse Zeit (zumeist 3 Monate). Die Tinnitus-App Kalmeda ist ein Pilotprojekt in Österreich, nachdem im Laufe des Jahres 2026 die ersten Bewilligungen von DiGA auch bei uns geplant sind.
Die künstliche Intelligenz wird auch die Hausarztpraxen maßgeblich beeinflussen, Spracherkennungssystem oder KI-Dolmetscher sind bereits existierende Beispiele, KI-Telefonassistenz wohl baldiger Standard in (Hausarzt-)Praxen.
Fazit
Zurück zum Anfang: Die Privatmedizin nimmt zu, das öffentliche Gesundheitssystem wird zunehmend „angeknabbert“ – ein Weg, den wir Ärzt:innen in der Primärversorgung definitiv nicht wünschen, da dies das soziale und medizinische Ungleichgewicht verstärkt. Digitalisierung ist eine Möglichkeit bzw. ein Aspekt, die Gesundheitsversorgung auf Kassenbasis effizienter zu gestalten, Primärversorgungseinheiten mit langen Öffnungszeiten ein weiterer. Um der Privatmedizin Paroli bieten zu können, braucht es auf jeden Fall eine deutliche Stärkung der Kassenmedizin, es dürfen aber in dem ganzen Prozess nicht die wesentlichen Kernaspekte unseres Faches verloren gehen, wobei hier die kontinuierliche Betreuung, der Überblick bei komplex kranken Patient:innen, der niederschwellige und vor allem barrierefreie Zugang (auch Digitalisierung kann Barrieren für Bevölkerungsgruppen bedeuten) und die wichtige Aufgabe der quartären Prävention hervorzuheben sind. Es bleibt spannend.