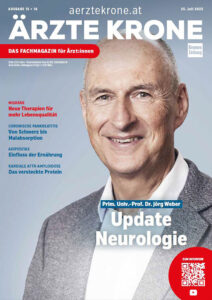Die gebräuchlichste Definition von Adipositas bezieht sich auf einen BMI > 30 kg/m2. Adipositas ist jedoch ein komplexes multifaktorielles Erkrankungsbild, wobei ursächlich beispielsweise genetische Faktoren neben Über- und Fehlernährung, sozioökonomischem Status, schlechter Schlafqualität, Gewicht der Eltern oder diversen Umweltfaktoren angenommen werden.
Die zunehmende, nahezu ubiquitäre Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln im Allgemeinen, jedoch auch insbesondere von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln mit hoher Energiedichte, hohem Fett- und Zuckergehalt, aber geringem Gehalt an Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen kann zu einer positiven Energiebilanz und zur Ansammlung von Körperfett bzw. Entwicklung von Adipositas führen – unabhängig von der Makronährstoffzusammensetzung der Ernährung. Dies gilt vor allem in Zusammenschau mit einem zumeist überwiegend sitzenden Lebensstil, sodass auch vom „Sitzen als neuem Rauchen“gesprochen werden kann.
Entstehung von Adipositas
Im Hinblick auf Entstehung und Progression von Adipositas geht man dem Energiebilanzmodell (EBM) folgend von einer komplexen hypothalamischen Regulation des Körpergewichtes aus, wodurch Appetit und Nahrungsaufnahme, aber auch Energieverbrauch durch endokrine, metabolische und vegetative Signale gesteuert werden; Hirnstamm, höhere kortikale Zentren und das limbische System – auch durch externe Einflüsse aus der Umgebung – sind ebenfalls beteiligt. Demzufolge ist die Quantität der aufgenommenen und letztlich nicht adäquat verbrauchten Kalorien entscheidend.
Einen weiteren möglichen Erklärungsansatz gibt das Kohlenhydrat-Insulin-Modell (CIM), das von postprandialen Blutzuckerspitzen und einer überschießenden Insulinantwort bei Verzehr von ultrahochverarbeitetenLebensmittelnmithohemglykämischem Index ausgeht, wodurch es zu einer Begünstigung des Fettgewebeaufbaus kommt – bei gleichzeitiger Unterdrückung der aus dem Fettgewebe freigesetzten Energie. Hierbei steht überwiegend die Qualität der aufgenommenen Nahrung im Vordergrund.
Darüber hinaus wird das menschliche Mikrobiom bei gesunden Individuen mutmaßlich mehr durch Ernährung und Umweltfaktoren beeinflusst als durch genetische Faktoren. In Übereinstimmung damit konnte in größeren metagenomischen Studien ein Einfluss auf das Darmmikrobiom durch den übermäßigen Verzehr ultrahochverarbeiteter Lebensmittel und damit ferner eine Assoziation mit der Entstehung von Adipositas gezeigt werden.
Mechanismen auf zellulärer Ebene
Letztlich kann die weltweite Zunahme der Adipositasprävalenz durch diese Modelle nicht ausreichend erklärt werden, weshalb neuere Hypothesen neben der Ernährung auch tiefgreifende Veränderungen auf zellulärer Ebene in Betracht ziehen, mitunter hervorgerufen durch Umweltfaktoren.
Das Reduktions-Oxidations-Modell (REDOX) basiert auf reduzierenden bzw. oxidierenden Stoffwechselprozessen auf mitochondrialer Ebene, wobei durch Bildung von freien Sauerstoffradikalen und NADH ein energieabhängiges Kommunikationssystem in jeder Zelle entsteht, das wesentlich am Fettgewebeaufbau beteiligt sein kann.
Das Obesogen-Modell (OBS) geht von einem signifikanten Einfluss von Umweltfaktoren bzw. -chemikalien, sog. Obesogenen, auf endokrine und metabolische Prozesse im menschlichen Körper und damit Gewichtszunahme und Adipositas aus. Obesogene können natürliche (z. B. Metalle, Viren), anthropogene (verschreibungspflichtige Medikamente), umweltbedingte (z.B. Pestizide, Phthalate, Bisphenol A, Haushaltschemikalien, Feinstaub) oder Nahrungsmittelbestandteile (z. B. Fruktose, Transfette, Konservierungsmittel, Emulgatoren) sein.
Ein weiterer wesentlicher Faktor in der Entwicklung von Adipositas bzw. metabolischen Erkrankungen ist die sog. Chrononutrition. Es konnte gezeigt werden, dass biologische Rhythmen hormonelle Regelkreise im menschlichen Körper beeinflussen. Nahrungsaufnahme, Appetit, Verdauung und Stoffwechsel weisen jeweils zirkadiane Muster auf. Wann welche Nahrungsmittelkombination aufgenommen wird, kann demnach äußerst unterschiedliche Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben und adressiert vor allem das ubiquitäre Nahrungsangebot der sog. Western Diet mit ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln und nächtlichen Mahlzeiten. Eine Kalorie ist eben nicht gleich „eine Kalorie“.
Negative Kalorienbilanz ist nicht alles
Die Bedeutung der erwähnten Ernährungsmodelle bei der Entstehung von Adipositas soll die Komplexität dieser Erkrankung verdeutlichen. Die häufig für die Entstehung von Adipositas herangezogene Energiebilanz legt den Schluss nahe, dass das Erreichen eines Energiedefizits willkürlich steuerbar ist und durch eine Verringerung der Energiezufuhr und Erhöhung des Energieverbrauches durch vermehrte Bewegung eine Gewichtsabnahme herbeigeführt werden kann. Die langfristige schlechte Effektivität dieser Lebensstilmaßnahmen ist wissenschaftlich jedoch gut belegt.
Darüber hinaus werden auch weitere negative Folgen durch häufige Gewichtsab- und zunahmen diskutiert, wie physiologische Veränderungen während der Gewichtsabnahme, die eine neuerliche Zunahme fördern bzw. für eine langfristige Adipositasentwicklung verantwortlich sind, weshalb von Crash-Diäten generell abzuraten ist.
Lifestyle-Modifikationen müssen dauerhaft umsetzbar sein
Tatsächlich muss eine Veränderung der Lebensgewohnheiten Basis jedweder Adipositastherapie sein – unabhängig davon, ob es sich um ein konservatives oder chirurgisches Prozedere handelt. Hierbei kann aber nicht DIE Diät empfohlen werden. Vielmehr ist die Regulierung des Gewichtes ein lebenslanger Prozess, der erfordert, dass eine gesunde, zuckerarme, ballaststoffreiche, fettmodifizierte Ernährungsweise (Stichwort mediterrane Ernährung) etabliert wird, die auch dauerhaft umgesetzt werden kann. Interindividuelle Unterschiede und die Berücksichtigung individueller psychologischer Faktoren im Hinblick auf die langfristige Verhaltensänderung müssen dabei besonders beachtet werden.
Medikamentöse Therapieoptionen
Bezüglich medikamentöser Therapieoptionen stehen mit inkretinbasierten Substanzen erstmals wirkungsvolle Medikamente zur Adipositastherapie zur Verfügung. Bei den aktuell durch die EMA zugelassenen Wirkstoffen handelt es sich um Liraglutid und Semaglutid, beides GLP-1-Rezeptoragonisten, sowie Tirzepatid, einen dualen GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten für Menschen mit einem BMI > 30 kg/m2, also bei Vorliegen einer Adipositas oder auch bei Übergewicht mit einem BMI > 27 kg/m2 und zumindest einer gewichtsassoziierten Begleiterkrankung.
Das größte Abnehmpotenzial konnte in Studien für Tirzepatid gezeigt werden, in denen eine mittlere Gewichtsabnahme von ca. 22% nachgewiesen werden konnte (vgl. ca. 15 % unter Semaglutid, ca. 8 % unter Liraglutid) und somit erstmalig eine mit einem bariatrisch-chirurgischen Eingriff vergleichbare Effektivität einer pharmakologischen Therapie gegeben ist.
Allen gemeinsam ist eine subkutane Verabreichungsweise, eine – abgesehen von meist nur initial bestehenden gastrointestinalen Nebenwirkungen – gute Verträglichkeit, eine selbstständige Kostenübernahme durch die Patient:innen (Antiadipositasmedikamente gelten in Österreich als Lifestyle-Medikamente und sind nicht erstattungsfähig) sowie ein neuerlicher Anstieg des Körpergewichtes nach Absetzen der Therapie (um ca. 2/3 des abgenommenen Gewichtes innerhalb eines Jahres).
Abschließend sei erwähnt, dass es bislang noch keine definierte, effektive, evidenzbasierte Strategie zur Vermeidung von Adipositas gibt.