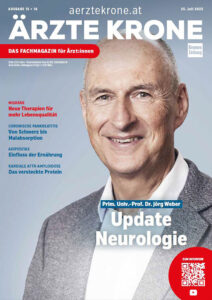Von der Losigkeit zur Verankerung
In ihren Anfängen war die Medizin „allgemein“. Die ursprüngliche Form des ärztlichen Handelns und Seins war die integrative und ganzheitliche Betrachtungsweise kranker Menschen – nicht die Betrachtung von Krankheiten – denn von diesen bzw. ihren anatomischen und (patho-)physiologischen Grundlagen wusste man zu wenig. Allgemeiner Gegenstand des Bemühens war also der Mensch, der Ort der Berufsausübung das Krankenbett, Grundlagen und Methoden waren wechselhaft. Mit der Antike entstand das Bemühen, Methodik, Beobachtung und Beschreibung in die Medizin zu bringen. Durch geschichtliche Querelen dauerte es bis zur europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert, bis sich die Medizin wie viele andere Wissenschaften deutlich weiterentwickeln konnte und sich zunehmend von der Reaktion am Krankenbett hin zur Aktion in kontrollierten Experimenten im Labor und strukturierter Erforschung verlagerte. Verbunden mit dem Wissenszuwachs entstand Subspezialisierung – durch die Fülle des Wissens war das Ende der allgemeinen Medizin eingeleitet. Neben dieser Fragmentierung blieben jene „übrig“, die nicht spezialisiert, nicht wissenschaftlich aktiv, sondern „praktisch“ am Kranken(-Bett) tätig blieben – die „praktischen Ärzt:innen“ oder „Hausärzt:innen“. Natürlich hat die Allgemeinmedizin auch weiterhin existiert, aus schierer Notwendigkeit für die Patient:innen heraus, aber sie hatte es in ihrem stillen Dienst versäumt, sich selbst zu definieren – treffend beschrieben mit dem Begriff des „allgemeinmedizinischen Losigkeitssyndroms“.
Die Allgemeinmedizin des späten 19. und zum Teil bis hinein ins 21. Jahrhundert hatte kein gutes Image, keine methodische Fundierung, keine einheitliche Fachsprache, keine Fachbegrenzung, keine eigene Identität, keine medizintechnische Praxisausstattung, keine selbstbestimmte Forschung, keinen Facharzttitel, wenig lehrbaren Stoff und keine universitäre Verankerung. Erst Mitte des letzten Jahrhunderts kam es zur Entwicklung eines eigenen Selbstbewusstseins, dass die Allgemein- und Familienmedizin nicht „der unbeschriebene Rest“ der Medizin ist. Die Fachdefinition und wissenschaftliche Erfassung führten zur Eigenständigkeit, zur Einführung der eigenen Methodik und allgemeinmedizinischen Forschung – wenn auch in Österreich als einem der letzten europäischen Länder. Das österreichische Gesundheitssystem hat auch aus dieser historischen Perspektive heraus lange weder die hausärztliche Profession noch die Primärversorgung als systemischen Begriff in ihrer tatsächlichen, umfassenden Bedeutung wahrgenommen. Erst seit das ungesteuerte öffentliche Gesundheitssystem an die Grenzen seiner Belastbarkeit gerät, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Disziplin der Allgemeinmedizin und ihre Systemfunktionen, derer sich andere Länder mit starker Primärversorgungsorientierung längst bedienen. Allerdings beschränkt sich dieser Blick auf diese eher administrativen Funktionen, die das Gesundheitssystems vor Überlastung schützen sollen (nicht nur in Österreich). Filterfunktion, Lotsenfunktion, Koordination der anderen „Gesundheitsdiensteanbieter“ und Gatekeeping sind die Schlagwörter. Was übersehen wird, ist, dass wir ein Gate, das nicht existiert, auch nicht „keepen“ können, dass wir nicht erfolgreich lotsen und koordinieren können, solange die alleingelassenen Patient:innen beinahe jede gewünschte Ebene selbständig und an uns vorbei ansteuern, solange wir Informationen von Mitbehandelnden – ärztlich und nichtärztlich – verzögert, unvollständig oder gar nicht bekommen, und solange wir mit organisatorisch-administrativen Aufgaben überlastet sind. Unsere Kernkompetenz ist die Gesamtsicht auf die einzelnen Patient:innen: die Defragmentierung, die gezielte, schlanke Diagnostik, die individualisierte, rationale Entscheidungsfindung, das Management komplexer Situationen, die medizinische Begleitung und Lenkung durch gesundheitliche Herausforderungen – physisch wie psychisch, kurzum – der integrierende Ansatz. Wir sind der Kitt zwischen den beteiligten Disziplinen und Professionen. Und das ist es, was das Gesundheitssystem sowie die Bevölkerung brauchen.