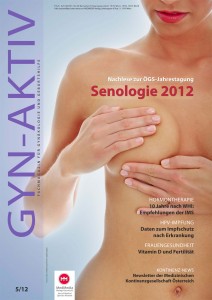Ärztin ohne Grenzen – „Existenzielle Grenzerfahrungen, die es lohnen“
So ein Einsatz bedeutet, sich mit anderen Menschen, anderen Kulturen, anderen Arbeits- und Lebensbedingungen auseinanderzusetzen, auf die man sich meist nur wenig vorbereiten kann. Als mir angeboten wurde, in Timergara/Pakistan in einer Geburtenklinik zu arbeiten, hatte ich mir reichlich Überlegungszeit genommen. Meine Neugier war stärker und schließlich entschied ich mich dafür, 5 Monate in ein Land zu reisen, das mit „westlichen“ Augen betrachtet nicht zwiespältiger sein könnte.
Der Ort, an dem ich arbeiten sollte, befand sich in einer der konservativsten Gegenden des Landes, im Nordwesten nahe der Grenze zu Afghanistan. Für die „Expats“ – wie die internationalen Mitarbeiter von ÄoG genannt werden – galten strikte Kleider- und Verhaltensregeln, die Grundlage für die Akzeptanz unter den Einheimischen und nicht zuletzt auch für die persönliche Sicherheit.
Das Projekt in Timergara/KPK operiert in Kooperation mit dem pakistanischen Gesundheitsministerium. ÄoG hat in einem staatlichen Spital die Leitung mehrerer Abteilungen übernommen – hierzu gehören unter anderem die Notfallaufnahme, die Geburtenklinik, der Notfall-OP und die postoperative Station.
Vor dem Einsatz machte ich mir viele Gedanken darüber, wie das Leben und die Arbeit in Timergara sein würde. Ich wusste, ich würde die einzige ÄoG-Gynäkologin sein und hatte auch eine ungefähre Idee von der Arbeitsbelastung. Auch war ich darüber informiert worden, dass ich das Haus, in dem ich mit anderen Expats zusammenleben würde, nicht verlassen durfte, außer für den Weg zum Krankenhaus. Dennoch hatte ich im Vorhinein keinerlei Vorstellung darüber, wie ich mit dieser Situation würde umgehen können.
Schon die Reise von Islamabad nach Timergara war ein Abenteuer: bunte Lastwägen, von Eseln gezogene Holzwägen, lange Basare voller Menschen, Frauen in Burka, Männer in ihren traditionellen Anzügen, militärische Grenzposten – viele spannende Momente, die ich allerdings aufgrund der Sicherheitsregeln nur durch das Autofenster erleben durfte.
Als Frau musste ich mich selbst auch gänzlich verschleiern. Die hier getragenen Gewänder nennt man „Shalwar Kameez“. Sie bestehen aus weiten Hosen, einer langärmligen, weiten Tunika, die unter dem Knie enden muss, und einem großen Tuch, das man so wickelt, dass nur die Augen freigelassen werden.
So befremdlich mir dies zunächst vorkam, ging ich so bekleidet in der Masse unter und wurde nicht sofort als Ausländerin wahrgenommen, was mir doch ein Gefühl der Sicherheit vermittelte.
Das Haus, in dem wir wohnten, hatte drei Stockwerke. Die Zimmer waren rund um einen freien Innenhof angelegt. Rundherum war es mit Blechwänden völlig von der Außenwelt abgeschirmt, nur durch einen schmalen Spalt zwischen Mauer und Blechwand konnte man hinauslugen und einen Blick auf den wunderschönen Hindukush erhaschen.
Meine Aufgabe bestand primär in der Leitung der Geburtenklinik sowie dem Durchführen geburtshilflicher Operationen und der Betreuung postoperativer Patientinnen. Im Vergleich zu der Menge an Patientinnen, die in Österreich pro Monat durchschnittlich betreut werden, waren die 550 geburtshilflichen Aufnahmen eine echte Herausforderung. Als einzige Ärztin mit nur rund 10 Hebammen musste ich mich sehr schnell an die Gegebenheiten anpassen, um gute Arbeit leisten zu können. Zur Unterbringung der 550 Frauen standen lediglich 5 Betten und nur zwei Kreißsaalbetten zur Verfügung, was bedeutete, dass oft bis zu 3 Frauen gleichzeitig in einem Bett lagen. Im Monat betreute mein Team rund 400 Spontangeburten, 80 Sectiones, 40 Aborte, 10 Hysterektomien, 5 Tubargraviditäten, um nur einige Zahlen zu nennen.
Die durchschnittliche Geburtenrate liegt in dieser Gegend von Pakistan bei 6 Kindern pro Frau, meistens werden Frauen rund 10-mal schwanger.
Die Totgeburtenrate liegt bei 10 %. Am Anfang war jedes tote Kind eine seelische Belastung für mich – leider wurde es schnell zur Normalität in einer Umgebung, in der dies als gottgewollt akzeptiert wird.
Die Patientinnen kamen mit einer Heerschar an Verwandten an, wobei die weiblichen Verwandten bei ihnen in der Geburtenklinik blieben – ein allgemeines Platz- als auch ein Lautstärkeproblem –, während die Männer in einem Zelt vor den Stationen warteten. Von der Unterschrift für die OP-Einwilligung angefangen, trafen letztere praktisch alle Entscheidungen. Das war nicht immer leicht, denn oft verstanden sie nicht, dass nur eine OP ihre Frau retten konnte, und es verging sehr viel wertvolle Zeit, bis die Frau dann endlich operiert werden konnte.
Ich habe sehr viele Fälle von schweren Fehlbildungen – vor allem Hydro- und Anencephali – gesehen, die meiner Meinung nach auf eine MTHFR-Mutation (Methylentetrahydrofolat-Reduktase) aufgrund der häufigen Konsanguinität zurückzuführen sind. Da sie häufig keinen Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung und Vorsorge haben, wissen die Frauen oft nichts von den Fehlbildungen und so führen diese nicht selten zu schweren Komplikationen.
Praktisch täglich sahen wir schwere Präeklampsien, Eklampsien und Plazentalösungen, was wohl auch mit der mangelnden Vorsorge in Zusammenhang stehen dürfte.
Eine der größten Hürden für uns war der Missbrauch von Oxytocin durch niedergelassene Gynäkologen und „Lady Health Worker“. Der Wunsch nach einer schnellen, medikamentös gesteuerten Geburt führt oft zu einer Überdosierung außerhalb der Klinik. Die Frauen kamen schlussendlich schon im Schockzustand mit rupturierten Uteri ins Krankenhaus zur Hysterektomie.
Der körperliche Zustand mancher Patientinnen ist für uns in Europa kaum vorstellbar, und häufig habe ich mich gefragt, wie sie den beschwerlichen, oft mehrstündigen Weg in die Klinik überhaupt überleben konnten. Sie waren Kämpferinnen. Das mussten sie auch sein, denn ihre Lebensumstände waren widrig, umgeben von Armut, Analphabetismus, Hunger und Krankheit.
Für gewöhnlich konnten wir ihnen helfen, aber immer wieder scheiterten wir an unseren beschränkten Ressourcen. Am wichtigsten für das Überleben dieser Frauen waren Blut und Blutprodukte. Blut wurde von Angehörigen gespendet, wobei wir darauf angewiesen waren, dass diese eine kompatible Blutgruppe besaßen. Blutplättchen waren überhaupt nicht erhältlich, dabei wäre dies bei großem Blutverlust fast die wichtigere Komponente gewesen.
Unsere gut funktionierende Schwangerenvorsorge gewohnt, stand ich solchen Komplikationen zugegebenermaßen zunächst einige Sekunden mit Ohnmacht und Angst gegenüber. Doch dann wurde mir klar, dass ich in der schier ausweglos erscheinenden Situation die einzige war, die diese Operation durchführen konnte und dass genau das meine Aufgabe in diesem Einsatz war: mein Bestes zu geben.
Nur mit einem sehr guten Team kann diese physische und psychische Belastung bewältigt werden, und ich hatte das Glück, mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die ich für ihr Können und Engagement nicht genug bewundern kann.
Ob Hebammen, Schwestern oder OP-Team, alle waren zu eigenständiger Arbeit streng nach den Protokollen von ÄoG fähig und darüber hinaus bereit dazu, auch ihr Bestes zu geben und nach Möglichkeit dazuzulernen.
In den ÄoG-Projekten arbeiten nur wenige internationale Helfer, die sich darüber hinaus alle paar Monate abwechseln, und so sind die nationalen Mitarbeiter von großer Bedeutung, vor allem in auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Projekten wie in Timergara.
Sie waren es auch, die mir geholfen haben, mit den kulturellen Barrieren umzugehen. Sie waren Sprachrohr und Sprachlehrer, teilten Essen und Trinken mit mir, außerdem ihre Kultur und Religion, brachten mir das richtige Verhalten bei und wiesen mich darauf hin, wenn mein Kopftuch einmal nicht richtig saß. Aus gutem Grund sind die Pashtun, Einwohner dieser Region Pakistans, für ihre Gastfreundschaft bekannt. Kein Tag verging ohne eine gemeinsame Tasse Tee oder typisch pakistanische Snacks.
Timergara ist ein Ort, der einen an seine eigenen Grenzen stoßen lässt – Grenzen fachlicher, aber auch persönlicher Natur. Ich bin froh, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen. Das Leben dort war sehr hart, die Arbeit ermüdend und ernüchternd, und doch wurde vieles durch die Gastfreundschaft und Warmherzigkeit der Menschen, mit denen die Zusammenarbeit fast immer lustig und reibungslos war, wettgemacht. Sogar in scheinbar ausweglosen Situationen. Ein Gläschen Tee und ein „Pakora“ zum Essen kann so einiges wieder gut machen!
Ich bin dankbar dafür, dass ich in ihre Welt eintauchen durfte, auch wenn mir klar ist, dass ich doch nur an der Oberfläche gekratzt habe!
„Ärzte ohne Grenzen“ sucht dringend FachärztInnen der Gynäkologie und Geburtshilfe für weltweite humanitäre Einsätze!
Bei Interesse bitte E-Mail an Herrn Hartmut Pachl
Weitere Information auf: www.aerzte-ohne-grenzen.at/auf-einsatz-gehen