Neue Erkenntnisse bei Herzmuskelerkrankung
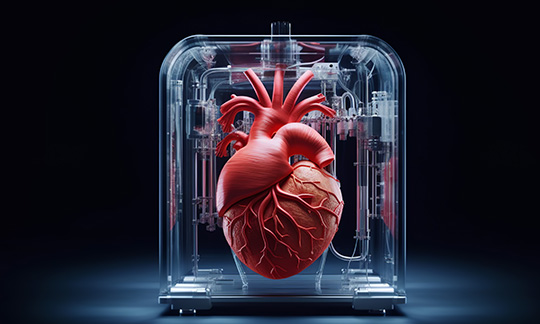 © AIExplosion – stock.adobe.com
© AIExplosion – stock.adobe.com Eine internationale Studie mit Beteiligung der MedUni Graz prüfte ein neues Arzneimittel gegen nicht-obstruktive hypertrophe Kardiomyopathie – mit wichtigen Ergebnissen.
Eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung der Cleveland Clinic und mit starker Beteiligung der MedUni Graz hat neue Erkenntnisse zur Behandlung der nicht-obstruktiven hypertrophen Kardiomyopathie (HCM) veröffentlicht. In der ODYSSEY-HCM-Phase-3-Studie wurde der Wirkstoff Mavacamten geprüft, der zur Gruppe der Myosin-Inhibitoren zählt und direkt auf die Herzmuskelzellen wirkt. An der bislang größten Untersuchung zu HCM nahmen 580 Patient:innen aus 22 Ländern teil. Ziel war die Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Im Vergleich zu Placebo ergaben sich jedoch keine signifikanten Vorteile. Bei einigen Teilnehmenden wurde eine vorübergehende Abschwächung der Herzpumpfunktion beobachtet, die engmaschig kontrolliert wurde. „Ein möglicher Nutzen von Myosin-Inhibitoren könnte höchstens bei ausgewählten Patient:innen bestehen“, erklärte Studienautor Nicolas Verheyen von der MedUni Graz. Damit liefere die Studie wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung zukünftiger Therapien.
Die Grazer Forschenden waren maßgeblich beteiligt: Österreich war Standort des ersten europäischen Studieneinschlusses, und das Team der MedUni Graz konnte zehn Patient:innen rekrutieren. Auch wenn Mavacamten keine klaren Vorteile bei nicht-obstruktiver HCM zeigte, unterstreichen die Ergebnisse den hohen Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten. Die MedUni Graz will ihre Rolle in der internationalen Forschung weiter ausbauen. „Wir wollen unsere Kooperationen vertiefen und einen Beitrag zur Entwicklung neuer Therapieansätze leisten“, betonte Verheyen. Damit bleibt die internationale Zusammenarbeit entscheidend, um seltene Erkrankungen wie die HCM umfassend zu verstehen und gezielt behandeln zu können.
Die Studienergebnisse erschienen im „New England Journal of Medicine“. Die genetisch bedingte Erkrankung, die bis zu eine von 200 Personen betrifft, verursacht Atemnot, Brustschmerzen oder Herzrhythmusstörungen und kann zu Herzschwäche oder plötzlichem Herztod führen. Für die nicht-obstruktive Form gibt es bisher kaum spezifische Therapien. (red)
SERVICE: Publikation





















































































