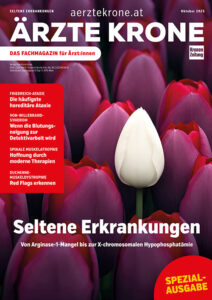Wann an erbliche Rachitisform denken?
Der Begriff Rachitis bezeichnet eine Gruppe von Erkrankungen, die durch Störungen im Mineralhaushalt zu Pathologien der Mineralisation der Wachstumsfugen und Knochen (Osteomalazie) führen, was sich in charakteristischen Beindeformitäten und vermindertem Längenwachstum zeigt. Das Erkennen einer Rachitis sowie die anschließende Erfassung der Ursache sind essenziell für die Behandlung und die Vermeidung von oftmals lebenslang bestehenden Beschwerden.
Differenzialdiagnostische Abgrenzung
Während sich die nutritive Rachitis meist durch reguläre Vitamin-D-Substitution schnell bessert, sind für die erblichen Rachitisformen andere Therapien notwendig.
Die nutritive Rachitis entsteht durch Vitamin-D-Mangel oder unzureichende Kalziumzufuhr und lässt sich durch adäquate Substitution mit Cholecalciferol und Kalzium erfolgreich behandeln. Neben Vitamin-D- bzw. kalziumarmer Ernährung stellen dunkles Hautkolorit, Verdeckung großer Hautpartien, aber auch Resorptionsstörungen des Darms Risikofaktoren für die Entwicklung dieser prinzipiell reversiblen Erkrankung dar.
Auch Nierenerkrankungen wie das Fanconi-Syndrom (generelle Tubulusfunktionsstörung) können rachitisähnliche Veränderungen verursachen, da der Körper ständig Mineralstoffe durch den Harn verliert.
Die X-chromosomale Hypophosphatämie (XLH) ist die häufigste erbliche Rachitisform, Ursache sind Mutationen im PHEX-Gen.
Erstmanifestationen und Red Flags
Typische Warnsignale für XLH sind:
- progressive Beindeformitäten (O-Beine oder X-Beine) trotz normaler Vitamin-D-Spiegel (> 50 nmol/l)
- spontane Zahnabszesse und Zahnfleischprobleme ohne erkennbare Karies
- disproportionaler Minderwuchs mit verkürzten Beinen
- Veränderungen der Schädelform (Dolichozephalie, Kraniosynostose)
Diagnostikpfad bei XLH
Bei Verdacht sollten eine kinderorthopädische Vorstellung und spezielle Laboruntersuchungen erfolgen: Serum-Phosphat, Kalzium, alkalische Phosphatase (ALP) und Parathormon (PTH). Bei XLH zeigt sich ein typisches Muster eines verminderten Serum-Phosphats bei normalem Kalzium und wenig erhöhtem PTH, während bei der Vitamin-D-Mangel-Rachitis das Phosphat oft noch normal ist, PTH und ALP jedoch sehr stark ausgelenkt sind.
Besonders wichtig: Viele Labors in Österreich verwenden keine altersgerechten Referenzwerte für Phosphat, was die Diagnose entscheidend verzögern kann.
Ein Handwurzelröntgen zeigt rachitische Veränderungen der Wachstumsfugen, was im Verlauf gut für ein Therapiemonitoring herangezogen werden kann.
Therapie bei XLH
Moderne medikamentöse Therapieoptionen – FGF-23-Antikörper Burosumab: Die Behandlung von XLH hat sich revolutioniert. Während früher nur die Kombination aus Phosphatsupplementen und aktivem Vitamin D (Calcitriol oder Alfacalcidol) zur Verfügung stand, gilt heute Burosumab als in vielen Fällen effektivste Therapiewahl. Burosumab ist ein monoklonaler Antikörper gegen FGF-23, der in Europa ab dem vollendeten ersten Lebensjahr zugelassen ist und alle zwei Wochen subkutan injiziert wird. Diese gezielte FGF-23-blockierende Therapie normalisiert den Phosphatstoffwechsel effektiver als die konventionelle Behandlung und reduziert Nebenwirkungen wie Hyperparathyreoidismus und Nierenverkalkungen.
Bei Nichtverfügbarkeit von Burosumab bleibt die konventionelle Therapie mit mehrmals täglichen Phosphatgaben und aktivem Vitamin D eine Option, sie erfordert aufgrund der schmalen therapeutischen Breite aber engmaschige Kontrollen und große Erfahrung im Management.
Orthopädische Interventionen: Neben der medikamentösen Therapie sind oft orthopädische Korrekturen erforderlich. Moderne Verfahren umfassen minimalinvasive Methoden wie Wachstumslenkung (Hemiepiphysiodese) bei offenen Wachstumsfugen oder Korrekturosteotomien bei ausgeprägten Deformitäten oder abgeschlossenem Wachstum. Die Abwägung der Notwendigkeit eines Eingriffs für die Lebensqualität der oftmals schwer betroffenen Patient:innen erfordert Erfahrung und eine enge Zusammenarbeit zwischen Endokrinologie und Orthopädie. Die richtige Indikationsstellung sowie präoperative Optimierung des Knochenhaushaltes sind essenziell für optimale Ergebnisse. An unserem Zentrum wird die spezifische endokrinologisch-osteologische Freigabe vor geplanten orthopädischen Eingriffen seit Jahren unter dem Begriff „Bone Clearance“ für bestmögliche OP-Ergebnisse durchgeführt.
Multidisziplinäre Versorgung als Schlüssel
XLH erfordert eine lebenslange, multidisziplinäre Betreuung. Neben Pädiatrie/Endokrinologie und Orthopädie sind Zahnmedizin, Physiotherapie und bei neurologischen Komplikationen auch Neurochirurgie eingebunden. Die Transition von der Kinder- in die Erwachsenenmedizin muss sorgfältig geplant werden. Das Vienna Bone and Growth Center, ein Zusammenschluss von AKH Wien, Orthopädischem Spital Speising und Hanusch-Krankenhaus, stellt als nationales und europäisches Referenzzentrum für seltene Knochenerkrankungen die spezialisierte Versorgung von Kindern und Erwachsenen mit seltenen Knochenerkrankungen wie XLH sicher.