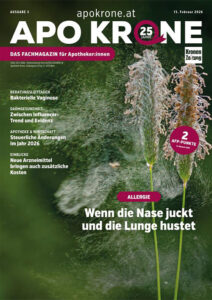Personen mit schweren psychischen Erkrankungen weisen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein niedrigeres Level an körperlicher Aktivität und mehr sitzendes Verhalten auf. Oftmals treten zudem im Krankheitsverlauf körperliche Begleiterkrankungen auf, u. a. kardiovaskuläre Erkrankungen oder das metabolische Syndrom. Die positiven Effekte von Bewegung auf die körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind mittlerweile gut dokumentiert. In den letzten Jahren konnten zudem positive Effekte auf Symptome verschiedenster psychiatrischer Krankheitsbilder, u. a. der Schizophrenie, Depression oder bei Angststörungen, gezeigt werden. Darüber hinaus sind positive Effekte auf die Lebensqualität und das Funktionsniveau beschrieben. Die antidepressiven Wirkmechanismen von Bewegung sind Gegenstand intensiver Forschung und dürften biologische, psychologische sowie psychosoziale Faktoren involvieren. Die allgemeinen Bewegungsempfehlungen für Erwachsene beinhalten mindestens 150 Minuten ausdauerorientierte Bewegung mit mittlerer Anstrengung oder 75 Minuten mit höherer Anstrengung sowie zusätzlich muskelkräftigende Übungen an 2 Tagen. Die derzeit optimale Empfehlung hinsichtlich Frequenz, Intensität, Art und Dauer von Bewegungsinterventionen bei psychiatrischen Erkrankungen ist noch nicht final geklärt. Klare Ergebnisse zeigen sich jedoch dahingehend, dass angeleitete, supervidierte Bewegung größere Effektstärken erzielt als Bewegung ohne Anleitung. Die European Psychiatric Association empfiehlt als ergänzende Therapie bei depressiven Erkrankungen ein angeleitetes ausdauerorientiertes Training (mit oder ohne Krafttraining), bestehend aus 2–3 Einheiten über 45–60 Minuten pro Woche mit moderater Intensität. Um die Erkenntnisse der Forschung in die klinische Praxis zu übertragen, bedarf es zielgerichteter Interventionen. Implementierungsstrategien für Bewegungsinterventionen im psychiatrischen Behandlungssetting sollten u. a. Elemente der motivierenden Gesprächsführung mit Förderung der autonomen Motivation, Zielsetzung, Planung und Anleitung, aber auch die Erfassung und Berücksichtigung von Barrieren (z. B. fehlende soziale Unterstützung), Psychoedukation und Aktivierung vorhandener Ressourcen beinhalten.