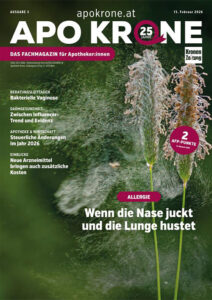Die wichtigsten Learnings vom WCLC-Kongress
Die diesjährige World Conference on Lung Cancer hat wieder spannende Erkenntnisse zum nichtkleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) gebracht. Im folgenden Beitrag wird eine Auswahl an interessanten Studien vorgestellt – mit wichtigen Implikationen für die Praxis.
Frühe Erkrankungsstadien
Die Immuntherapie ist mittlerweile in den frühen Erkrankungsstadien etabliert. Bei der NADIM-ADJUVANT-Studie1 handelt es sich um die erste randomisierte Phase-III-Studie, die einen positiven Effekt einer adjuvanten Chemo-Immuntherapie sofort nach der Operation zeigte. Die Daten für das krankheitsfreie (DFS) und Gesamtüberleben (OS) waren zum Zeitpunkt der Publikation zwar noch unreif, aber die Rückfallraten wurden im Nivolumab-Arm im Vergleich zum Kontrollarm deutlich reduziert. Die Besonderheit dieser Studie lag an der Ähnlichkeit zu Real-World-Daten, da alle Patient:innen nach der Resektion eingeschlossen wurden, obwohl die postoperative Mortalität sowie die Toxizität während der adjuvanten Chemo-Immuntherapie das DFS beeinflussen können. Die Zeit, bis die ersten 25 % der Patient:innen das DFS erreichten, war in der Kontrollgruppe im Vergleich zum Nivolumab-Arm deutlich kürzer, also ein klares Zeichen, dass das DFS mit dieser Strategie verbessert werden kann.
Darüber hinaus wurde die finale Analyse der RATIONALE-315-Studie2 präsentiert. Die Ergebnisse unterstützen den perioperativen Einsatz von Tislelizumab in Kombination mit Chemotherapie bei resektablem NSCLC: Die Sterblichkeit wurde damit um 35 % reduziert. Das mediane OS wurde noch nicht erreicht; nach 4 Jahren lebten noch 72,3 % der Patient:innen im Tislelizumab-Arm, verglichen mit 62,2 % im Placebo-Arm. Das mediane ereignisfreie Überleben (EFS) wurde unter Tislelizumab ebenso noch nicht erreicht – im Gegensatz zu Placebo: Hier betrug es 30,6 Monate.
Eine weitere spannende Erkenntnis betrifft die MRD-Analyse der NeoADAURA-Studie3, deren Ergebnisse heuer bereits beim ASCO4 vorgestellt wurden. Patient:innen, deren Tumor operabel und EGFR-mutiert war, wurden in 3 Gruppen eingeteilt: neoadjuvantes Osimertinib, neoadjuvantes Osimertinib + Chemotherapie und Chemotherapie + Placebo. Der primäre Endpunkt, nämlich eine komplette pathologische Remission, wurde klar erreicht. Bei 26 % der Patient:innen im Osimertinib-Chemotherapie-Arm und bei 25% im Osimertinib-Arm waren nach der neoadjuvanten Therapie keine Tumorzellen im entnommenen Gewebe mehr nachweisbar, im Gegensatz zu 2 % im Placebo-Chemotherapie-Arm. In der beim WCLC vorgestellten Studie3 wurde nun nachgewiesen, dass eine Liquid Biopsy, also der Nachweis von Tumor-DNA der EGFR-Mutation im Blut (MRD=minimale Resterkrankung), ein besseres Verständnis und geeignetere Selektion der Patient:innen bieten kann. Die MRD-Bestimmung erfolgte zu Studieneinschluss und vor der Operation. Einerseits zeigte sich, dass MRD-negative Patient:innen ganz klar ein besseres Outcome haben als jene, bei denen noch Tumor-DNA nachweisbar ist, andererseits, dass neoadjuvantes Osimertinib zu einer deutlichen Reduktion von Tumor-DNA führte (MRD-Clearance).
Zielgerichtete Therapien
Mit Spannung wurde die finale OS-Analyse der FLAURA2-Studie5 erwartet. Wir erinnern uns: In dieser Phase-III-Studie wurden Patient:innen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem, EGFR-mutiertem NSCLC in einen Osimertinib-Arm und in einen Osimertinib-Chemotherapie-Arm randomisiert.6 Die Kombination von Osimertinib + Chemotherapie führte zu einem signifikant verlängerten progressionsfreien Überleben (PFS) im Vergleich zur Osimertinib-Monotherapie bei akzeptabler Toxizität.6 Was wir bisher noch nicht gesehen haben, war das OS – auch hier zeigte sich ein klarer Vorteil für die Kombination Osimertinib + Chemotherapie: Die Mortalität wurde damit um 23 % im Vergleich zur Monotherapie reduziert, das mediane OS war um fast 10 Monate länger. Dieser klare Überlebensvorteil zeigte sich auch durch alle Subgruppenanalysen hindurch konsistent. Die Kombinationstherapie war zwar erwartungsgemäß mit mehr Nebenwirkungen verknüpft, diese waren aber managebar und verursachten kaum zusätzliche Therapieabbrüche.5 Mit der vergleichbaren MARIPOSA-Studie7, die bereits beim Europäischen Lungenkrebs-Kongress vorgestellt wurde, haben wir nun neben Amivantamab + Lazertinib eine weitere Kombinationsmöglichkeit für diese Situation. Wir werden in Zukunft jedenfalls noch besser verstehen müssen, wer von welcher Therapie am besten profitiert; trotzdem kann auch die Monotherapie für manche Patient:innen eine durchaus gute Option sein.
Eine andere Möglichkeit, nämlich dass zum Zeitpunkt des Progresses auf Osimertinib auch eine Chemotherapie gestartet werden kann, hat die COMPEL-Studie8 betrachtet. Hier haben die Patient:innen, nachdem sie auf Osimertinib progredient waren, entweder Osimertinib + Chemotherapie oder Placebo + Chemotherapie erhalten. Auch in diese Phase-III-Studie wurden metastasierte Stadien miteingeschlossen; sie fiel mit 98 Patient:innen etwas kleiner als geplant aus. Hinsichtlich PFS zeigte sich ein beeindruckender Vorteil für die Osimertinib-Kombination: Das mediane PFS war hier um 4 Monate länger, und Osimertinib + Chemotherapie reduzierte das Risiko einer Progression um 57 %. Dieser Vorteil galt insbesondere für Patient:innen mit Hirnmetastasen. In Bezug auf OS musste diese Studie allerdings negativ bewertet werden.
Sicherlich auch mit Spannung erwartet wurden die Ergebnisse zu Ivonescimab, einem bispezifischen monoklonalen Antikörper: In die große Phase-III-Studie HARMONi9 wurden Patient:innen mit EGFR-Mutation, die unter einem Tyrosinkinase-Inhibitor progredient wurden, in die Arme Ivonescimab + Chemotherapie bzw. Placebo + Chemotherapie randomisiert. Ivonescimab hemmt gleichzeitig VEGF- und PD-1-Signalwege und adressiert damit typische Resistenzmechanismen nach EGFR-gerichteter Therapie. Hinsichtlich der Effektivität beim PFS waren die Ergebnisse mit der MARIPOSA-Studie7 vergleichbar, der Wirkstoff erwies sich auch als gut verträglich. Beim wichtigsten primären Endpunkt jedoch, dem OS, wurde statistische Signifikanz knapp verfehlt. Aufgrund dessen ist der Vorteil von Ivonescimab für EGFR-mutierte Patient:innen fraglich; die Substanz könnte aber bei anderen NSCLC-Typen wirksam sein.
Experimentelle Therapie für nichtoperable Tumoren
Bei CAN-240910 handelt es sich um eine experimentelle Krebsimmuntherapie auf Basis eines replikationsdefekten Adenovirus, der direkt in den Tumor appliziert wird. Valaciclovir wird in Kombination als Prodrug eingesetzt. Hier wurden Patient:innen mit nichtresezierbarem Stadium-III/IV-NCSLC, die auf Immuntherapie nicht ansprachen oder progredient wurden, eingeschlossen. Das mediane OS war für dieses Patientenkollektiv, trotz extrem schlechter Prognose, mit 24,5 Monaten beeindruckend lang. Bei jenen Patient:innen, die unter der Immuntherapie sofort progredient waren, lag es immerhin noch bei 21,5 Monaten, was als ein deutlich positives Signal zu werten ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir in Österreich dazu bald Studienangebote bekommen.
Etablierte Therapie in neuer Form
Neue Langzeitdaten bestätigten: Atezolizumab kann auch subkutan eingesetzt werden, dies wurde von den meisten Patient:innen gegenüber der intravenösen Formulierung bevorzugt. Die finale Analyse konnte zeigen, dass Atezolizumab s.c. im Vergleich zu i.v. ähnliche patientenberichtete Endpunkte (PRO) aufweist – bei vergleichbarer Wirksamkeit und Sicherheit.11 Atezolizumab ist somit die erste Immuntherapie, die wir beim Lungenkrebs subkutan einsetzen können. Für unsere Patient:innen bedeutet die Verabreichung einer Spritze anstatt einer Infusion eine wesentliche Erleichterung. Die subkutane Formulierung ist seit Anfang letzten Jahres in der EU verfügbar.