Psychische Versorgung | Herausforderung: Stigmatisierung und Unterversorgung
Michael Musalek: Die größte Herausforderung liegt leider noch immer in der Frage: Wie können wir Menschen dazu bringen, in Behandlung zu gehen? Um ein sehr dramatisches Beispiel zu nennen: Bei der Alkoholkrankheit dauert es in der Regel zwischen 3 und 7 Jahren, im Schnitt erfolgt der Behandlungsbeginn nach 5 Jahren manifester Erkrankung. Da es sich bei dieser Erkrankung um eine tödliche Erkrankung handelt, erleben manche ihre Behandlung gar nicht mehr, weil die Schwelle, in Behandlung zu gehen, noch immer viel zu hoch ist.
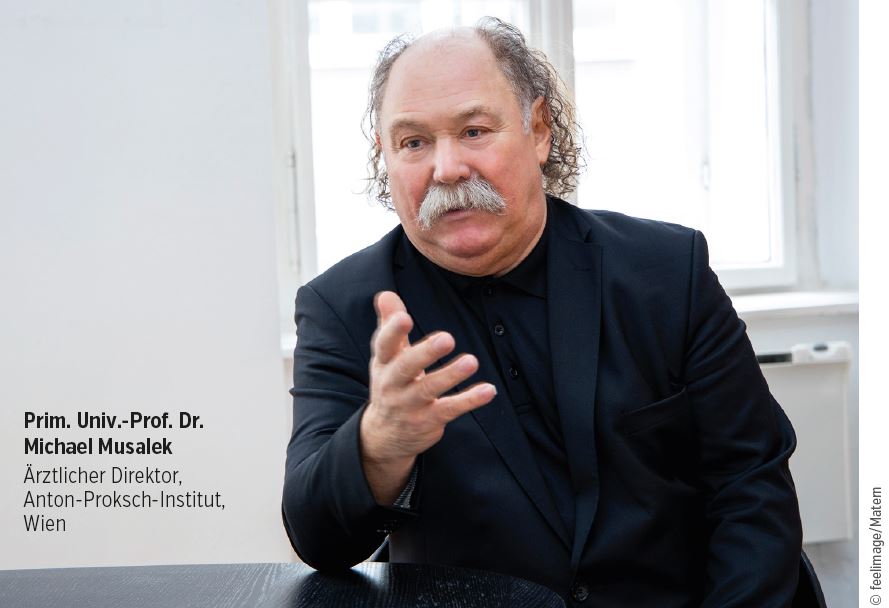 Warum ist die Schwelle so hoch?
Warum ist die Schwelle so hoch?
Das, was die Schwelle so exorbitant hinauftreibt, sind zwei Dinge. Zum einen ist das die Stigmatisierung der Erkrankung: Immer noch hat heute ein Magenulkus eine andere Wertigkeit in der Gesellschaft als eine Depression, wobei die Depression schon eine bessere Wertigkeit hat als die Suchterkrankung oder eine Schizophrenie.
Die zweite Ursache ist die immer noch unzureichende Verfügbarkeit der Behandlung. Wir haben in Österreich in manchen Regionen noch immer eine massive Unterversorgung. Besonders eklatant ist sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, darüber hinaus gibt es aber auch viele ländliche Gebiete, wo es keine psychiatrische und auch keine ausreichende psychotherapeutische Versorgung gibt und die nächste zuständige psychiatrische Klinik mehr als 100 km entfernt ist.
Wenn man einmal bis in die Höhen der Behandlung vorgedrungen ist, ist die Behandlung in der Regel gut wirksam. Insbesondere im ärztlichen, psychologischen und psychotherapeutischen Bereich ist der Standard sehr hoch. Dass es wie überall auch Verbesserungspotenziale gibt, ist keine Frage; ebenso, dass man mit mehr Qualitätssicherungsmaßnahmen im psychotherapeutischen Bereich da und dort noch etwas verbessern könnte. Aber das ist nicht unser Hauptproblem, sondern dass der Betroffene überhaupt dorthin kommt!
Hier spielt aus meiner Sicht der Allgemeinmediziner die entscheidende Rolle. Diesen sehe ich auch für psychische Erkrankungen insgesamt als die erste Anlaufstelle; das kann aus meiner Sicht nicht der Psychotherapeut, nicht der Psychologe, nicht der Psychiater und auch nicht der Neurologe sein, zwischen denen übrigens selbst gebildete Leute oft nicht unterscheiden können. Ich glaube, dass der Allgemeinmediziner sowohl als Anlaufstelle als auch in der Motivation des Patienten zur weiterführenden Therapie eine ganz zentrale Rolle einnimmt.
Je nach Ordination haben ja etwa 40 bis 60 Prozent der Patienten auch psychische Probleme – natürlich sind nicht alle schwer psychisch krank.
Genau das ist das Problem. Es ist jetzt zwar etwas besser, denn immerhin sind jetzt 3 Monate Psychiatrie in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner vorgesehen, früher war das überhaupt nur fakultativ.
Gerade die Depressionsdiagnostik, etwa um eine Trauerreaktion von einer Depression zu unterscheiden, ist eine schwierige und benötigt auch Erfahrung – und damit Zeit in der Ausbildung! Die Depression ist ja nicht über die Stimmung zu diagnostizieren; das Leitsymptom ist die Antriebsstörung. Ich glaube, es braucht insgesamt in der Medizin ein Mehr an Hinwendung zu den psychischen Störungen. Gerade beim Burn-out sehen wir es oft sehr deutlich: Die körperlichen Symptome werden angegangen, die Schlafstörung wird behandelt, ebenso die Erektionsstörung, aber was dahinter liegt, ist das Burn-out, und dieses sollte auch diagnostiziert werden …
Das große Problem in der Medizin generell – und das sehen wir überall und besonders auch in der Suchtmedizin – ist, dass die Motivation oft noch immer als eine Bringschuld des Patienten gesehen wird. Aber zumindest im psychiatrischen Bereich sehe ich hier eindeutig eine primäre Bringschuld des Arztes, der im Gegensatz zum Patienten in der Motivationsarbeit ausgebildet ist, der Patient macht es meist ja nur „learning by doing“. Wenn bei mir in der Klinik ein Kollege sagt, „Das ist ein unmotivierter Patient“, ist meine lakonische Antwort darauf: „Und wann beginnen Sie mit der Motivationsarbeit als erstem Schritt der Therapie?“ Wenn der Patient noch nicht motiviert ist, habe ich in der Regel noch nicht mit der Therapie begonnen!
Das sage ich auch in der Ambulanz … Ich halte Motivation für eine ganz zentrale Aufgabe des Arztberufes insgesamt. Unsere Aufgabe ist nicht nur, jemandem quasi etwas anzubieten, sondern ihn zu motivieren. Unsere Aufgabe ist es jedoch nicht, dass er es dann auch wirklich macht …
Hier hat sich sehr viel getan, aber immer noch viel zu wenig! Mit dem Outing von Robert Hochner hat sich damals viel bewegt, dennoch ist eine Depression auch heute noch massiv stigmatisierend. Als sich Lorenz Gallmetzer geoutet hat, hat er damit vielen Menschen geholfen, den Weg zu uns zu finden. Trotzdem ist die Alkoholkrankheit weiterhin unglaublich tabuisiert. „Viel zu saufen, ist super“, aber ab dem Zeitpunkt, wo man krank ist, will keiner mehr etwas mit einem zu tun haben.
In Summe sind psychische Erkrankungen noch immer extrem stigmatisiert. Das wirkliche Problem dabei ist, dass es die Prognose der Erkrankungen exorbitant schmälert, wenn Betroffene nicht oder erst sehr spät in Behandlung gehen. Und das ist gerade bei Erkrankungen, die heute hervorragend behandelbar sind, besonders bitter. Gerade die Therapie der Depression hat in den letzten 40 Jahren einen Quantensprung erfahren, nur vergleichbar der Infektionsbehandlung vor und nach Entwicklung der Antibiotika. Stigmatisierung ist nicht nur ein allgemeingesellschaftliches Phänomen, sondern immer auch ein unmittelbares individuelles.
Diese Frage eines Entweder-oder ist eigentlich nur standespolitisch motiviert. Vom wissenschaftlichen und vom klinisch-praktischen Standpunkt ist die Frage, ob ich jemanden pharmakologisch oder psychotherapeutisch behandle, absurd, weil wir ja als Menschen immer sowohl psychisches Wesen als auch körperliches Wesen sind. Das ändert sich ja nicht, nur weil wir krank sind. Deshalb brauchen in der Regel fast alle schweren psychischen Erkrankungen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch beides – sofern es überhaupt eine medikamentöse Behandlung gibt: In vielen Bereichen haben wir ja leider noch keine hoch effektive. Vor allem auch bei den schwereren Formen der Depression ist es nie ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch.
Die pharmakologische Therapie ist dabei ein wesentlicher Schritt, aber die Verschreibung eines Medikamentes ist noch keine Therapie. Sie gehört eingebettet in gute Motivationsarbeit und in gute psychotherapeutische Unterstützung. Es brauchen nicht alle Menschen eine Psychotherapie, aber stützende motivierende Gespräche braucht jeder, dann ist auch der pharmakologische Effekt gleich viel höher …
Genau. Der Satz stammt eigentlich von Ludwig Reiter, einem praktischen Arzt und Familientherapeuten: „Psychotherapie ist kein larmoyantes Herumreden, sondern ein chirurgischer Prozess.“ Wie beim chirurgischen Prozess braucht es eine scharfe Klinge, aber auch eine zielsichere Hand, die den Schnitt richtig setzt – und vor allem eine Naht: Es reicht nicht, nur aufzudecken, man muss die Wunde, die durch den Schnitt entsteht, auch wieder nähen.
Eine Pandemie ist eine ansteckende Erkrankung, die sich sehr rasch potenzierend ausbreitet, auf sehr große Bevölkerungsschichten oder weltweit. Es gibt eine virale Pandemie – ausgelöst durch die Verbreitung des Virus. Es gibt aber auch eine psychosoziale Pandemie, die auch hochansteckend ist. Denn die psychosozialen Probleme des Einen induzieren psychosoziale Probleme des Anderen.
Die jetzige virale Pandemie werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Jahr im Griff haben. Die psychosoziale Pandemie wird uns aber noch Jahre begleiten.
Die psychosoziale Pandemie ist nicht weniger tödlich als die virale! Denken wir an die Suizidraten, denken wir aber auch an die vielen Menschen, die aufgrund von Ängsten nicht zu Ärzten gehen. Es waren ja plötzlich alle Arztpraxen leer; diese Menschen waren ja nicht plötzlich alle gesund, sondern wurden nur nicht behandelt, weil sie nicht zum Arzt gingen.
Es sind übrigens nicht nur die wirtschaftlichen Probleme, welche die psychosoziale Pandemie triggern, sondern es gibt auch eine Fülle anderer Faktoren. Wir untersuchen das gerade wissenschaftlich und publizieren dazu im Herbst auch eine Studie. Es gibt auch Menschen, die keine wirtschaftlichen Sorgen, aber dennoch psychosoziale Probleme haben. Denken wir nur an Patienten mit Angststörungen, die jetzt in massivste Ängste getrieben werden. Denken wir nur an Menschen im Home-office zu Hause auf engstem Raum mit Kindern, denken wir nur an die Beziehungsstörungen, die hier entstehen können.
Ich bin nicht dagegen – aber es muss uns auch bewusst sein: Der Großteil der Menschen leidet nicht am Virus, sondern vor allem an den Maßnahmen. Es ist leider ähnlich wie bei einem Brand: Den größten Schaden verursacht oft das Löschen.






















































































