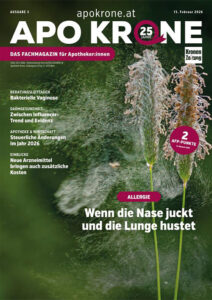Der Begriff Transition beschreibt in der Psychiatrie den geplanten, begleiteten Übergang von Patient:innen aus der kinder- und jugendpsychiatrischen in die erwachsenenpsychiatrische Behandlung. Anders als bei einer reinen „Überweisung“ steht dabei ein kontinuierlicher, entwicklungsorientierter Prozess im Mittelpunkt. Ziel ist die Sicherung der Behandlungskontinuität und die Förderung der Eigenverantwortung der jungen Erwachsenen.
Vom Du zum Sie
Das vertraute Du der Kindheit wird zum Höflichkeits-Sie, um auf Augenhöhe unter Erwachsenen sprechen zu können, und soll dabei nicht als „kalt“ empfunden werden. Die Klärung der veränderten Rahmenbedingungen nimmt dabei eine wichtige Stellung ein.
Neuromentale Entwicklungsstörungen
Die Transition betrifft vor allem Patient:innen mit chronischen oder rezidivierenden psychischen Erkrankungen – etwa affektive Störungen, ADHS, Essstörungen, Psychosen oder Persönlichkeitsentwicklungsstörungen. Im ICD-11 werden diese Störungen als neuromentale Entwicklungsstörungen (6A00-6A06) beschrieben, zum Teil als Komorbidität oder als Hauptdiagnose, wie bei den Autismus-Spektrum-Störungen. Der Wechsel erfolgt meist zwischen dem 17. und dem 19. Lebensjahr, also in einer Lebensphase, die ohnehin durch Veränderung geprägt ist: Schulabschluss, Ausbildung, erste Partnerschaften, Auszug aus dem Elternhaus.
Unterschiede der psychiatrischen Versorgungssysteme
Hinzu kommt: Die beiden psychiatrischen Versorgungssysteme unterscheiden sich in Struktur und Haltung deutlich. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP) ist stark familien- und entwicklungsorientiert, mit einem intensiven Einbezug der Eltern und multiprofessioneller Betreuung. Die Erwachsenenpsychiatrie hingegen legt mehr Gewicht auf Eigenverantwortung, Compliance und Symptomkontrolle, die Entwicklung zur Autonomie steht im Fokus.Wenn der Übergang unvorbereitet erfolgt, kann das zu Brüchen in der Versorgung führen – mit dem Risiko von Therapieabbrüchen, Rückfällen oder Verlust der Behandlungsmotivation. Studien zeigen, dass bis zu 50 % der Patient:innen nach der Entlassung aus der KJPP zunächst keine Anschlussbehandlung in Anspruch nehmen. Hier spielt auch das hausärztliche Umfeld eine zentrale Rolle: Hausärzt:innen sind häufig die einzigen konstanten medizinischen Bezugspersonen und können Übergänge früh erkennen und aktiv begleiten. Besonders wichtig ist dabei die Prävention, um sekundäre Schäden wie Suchtentwicklungen oder soziale Brüche im Leben nicht erst entstehen zu lassen.
Frühzeitige Planung und interdisziplinäre Zusammenarbeit
Eine gelingende Transition setzt daher frühzeitige Planung, klare Kommunikation und interdisziplinäre Kooperation voraus. Empfehlenswert ist, spätestens ab dem 16. Lebensjahr gemeinsam mit Patient:innen und Angehörigen einen individuellen Transitionsplan zu entwickeln. Dieser sollte Behandlungsverlauf, Medikation, therapeutische Ziele, Unterstützungsnetzwerke und Ansprechpartner:innen dokumentieren.Darüber hinaus haben sich Transitionssprechstunden und gemeinsame Fallkonferenzen zwischen KJPP und Erwachsenenpsychiatrie bewährt, wie z. B. die Über-gabekonferenz gemeinsam mit Patient:innen und Therapeut:innen aus beiden Bereichen. Diese Formate ermöglichen eine schrittweise Übergabe sowie kläre Verantwortlichkeiten und reduzieren die Belastung für die Patient:innen. Ein wichtiger Bestandteil des Prozesses ist die Förderung von Selbstständigkeit: Jugendliche sollen zunehmend Verantwortung für Terminvereinbarung, Medikamentenmanagement und Kommunikation mit Therapeut:innen übernehmen. Ärzt:innen können diesen Schritt unterstützen, indem sie entsprechende Kompetenzen im Gespräch gezielt ansprechen und fördern.Auch Angehörige benötigen Begleitung: Eltern müssen lernen, Kontrolle loszulassen und Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Kinder zu entwickeln. Therapeut:innen können hier moderierend wirken und klare Rollenveränderungen transparent machen.
Sensibilität erleichtert die Transition
Auf Seiten der Erwachsenenpsychiatrie – und auch bei anderen Fachdisziplinen, die junge Patient:innen langfristig begleiten – ist Sensibilität gefragt: Viele erleben den Wechsel als Verlust vertrauter Strukturen. Ein validierendes, patientenzentriertes Vorgehen und das Einbeziehen entwicklungspsychologischer Aspekte erleichtern den Übergang erheblich.
Langfristig zielt Transition darauf ab, eine Brücke zwischen zwei Versorgungssystemen zu schlagen, die organisatorisch häufig voneinander getrennt agieren. Eine gut geplante Übergabe verbessert nicht nur die Adhärenz, sondern kann Krankheitsverläufe stabilisieren und dazu beitragen, Hospitalisierungen zu vermeiden.
Praxismemo
- Transition erfolgt am besten multidisziplinär: Eine strukturierte Übergabe beugt Versorgungslücken vor.
- Hausärzt:innen sollten frühzeitig über bevorstehenden Wechsel informiert werden, um Kontinuität zu gewährleisten.
- Jugendliche sollten bereits vor dem Wechsel neue Behandler:innen kennenlernen („Schnittstellenkontakte“).