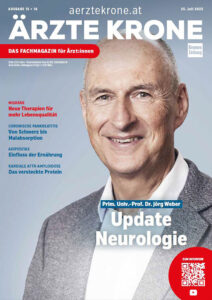Viele internistische Kolleg:innen kennen das Phänomen: Ein:e Patient:in mit Brustschmerzen wirkt verzweifelt, die EKG-Befunde sind unauffällig, doch die Sorge bleibt. Solche Situationen fordern nicht nur klinisches Urteilsvermögen, sondern auch kommunikative Feinfühligkeit. Herzangst ist nicht selten Ausdruck einer subjektiv bedrohlichen Krankheitswahrnehmung, auch wenn organisch (noch) keine Erklärung gefunden wurde.1 Hier kann Sprache Brücken bauen – oder Mauern errichten. Ein zentraler Aspekt ist das Erkennen und Ansprechen der Emotionen, ohne dabei in Psychologisierung oder Bagatellisierung zu verfallen. Gerade in der Akutsituation oder im Aufklärungsgespräch wirkt eine empathisch strukturierte Kommunikation stabilisierend – sie vermittelt Sicherheit und Orientierung.
Risikofaktor Stress
Chronischer psychosozialer Stress zählt heute neben der arteriellen Hypertonie, der Fettstoffwechselstörung, dem Diabetes mellitus und dem chronischen Nikotinkonsum zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung eines chronischen Koronarsyndroms.2 Auch das Auftreten von Herzrhythmusstörungen – insbesondere bei bereits vorgeschädigtem Myokard – kann durch anhaltende emotionale Belastung begünstigt werden.
Psyche beeinflusst Herzgesundheit
Emotionale Belastung aktiviert das sympathische Nervensystem, führt zu einer vermehrten Katecholaminausschüttung sowie Aktivierung des sympathischen Nervensystems und damit zu einer koronaren Vasokonstriktion – einem Mechanismus, der insbesondere bei vulnerablen Plaques klinisch bedeutsam werden kann. Gleichzeitig sinkt unter chronischem Stress die Herzfrequenzvariabilität (HRV), ein etablierter Marker für autonome Dysbalance. Eine verminderte HRV ist in zahlreichen Studien mit einer erhöhten kardialen Mortalität assoziiert.3 Auch kommt es zu einer Erhöhung des Kortisolspiegels.4 Diese enge Verbindung zwischen psychischer Befindlichkeit und kardialer Gesundheit unterstreicht, wie wesentlich es ist, emotionale Aspekte im ärztlichen Gespräch nicht zu übersehen.5 Kommunikation wird damit zu einem Schlüssel, um krankheitsrelevanten Stress früh zu erkennen und ihm aktiv zu begegnen.
Gesprächsführung als klinisches Werkzeug
Ein Gespräch kann beruhigen oder beunruhigen – je nach Struktur, Wortwahl, Tonfall und Körpersprache. Strukturelle Gesprächsmodelle helfen, emotionale Themen gezielt und gleichzeitig effizient zu adressieren. Besonders bewährt haben sich dabei die Calgary-Cambridge-Guidelines, ein evidenzbasiertes Rahmenmodell für medizinische Gesprächsführung.6 Sie bieten eine klare Struktur für das ärztliche Gespräch – vom Beziehungsaufbau bis zum gemeinsamen Planen.
Ein zentraler Baustein daraus ist das sogenannte WWSZ-Prinzip:
Warten: Dem Gegenüber Raum geben.
Wiederholen: Wichtige Inhalte oder Schlüsselbegriffe aufgreifen.
Spiegeln: Emotionen oder Aussagen in eigenen Worten zurückgeben.
Zusammenfassen: Strukturierend bündeln, was gehört wurde.
Diese einfachen, aber wirkungsvollen Techniken helfen, dem subjektiven Erleben der Patient:innen Raum zu geben, ohne den medizinischen Fokus zu verlieren, insbesondere bei Menschen mit Angst. Wenn Patient:innen das Gefühl haben, wirklich verstanden zu werden, entsteht nicht nur emotionale Entlastung, sondern auch mehr Offenheit für medizinische Erklärungen und Behandlungsvorschläge.
Emotionale Aspekte
Für den gezielten Umgang mit Emotionen hat sich das NURSE-Modell bewährt7:
Naming: Emotionen benennen („Sie wirken sehr beunruhigt …“).
Understanding: Verständnis zeigen („Das ist nachvollziehbar, so eine Diagnose verunsichert viele …“).
Respecting: Wertschätzung ausdrücken („Ich finde es bemerkenswert, wie offen Sie das ansprechen …“).
Supporting: Unterstützung anbieten („Wir gehen das gemeinsam Schritt für Schritt durch …“).
Exploring: Hintergründe erfragen („Was genau beunruhigt Sie am meisten?“).
Solche Formulierungen wirken oft stärkend, weil sie Emotionen ernst nehmen, ohne sie zu dramatisieren. Sie helfen Patient:innen, sich in ihrer Angst gesehen zu fühlen, was wiederum Vertrauen aufbaut und eine aktivere Mitwirkung an Diagnostik und Therapie ermöglicht. Es ermöglicht aber auch Ärzt:innen, sich in schwierigen Gesprächssituationen zu orientieren und damit selbst bei starken Emotionen einfühlsam und stabil zu bleiben.
Depression im Blick behalten
Mehr als 20 % der Patient:innen entwickeln nach einem Herzinfarkt eine depressive Episode, in milderer Ausprägung sind affektive Symptome sogar noch häufiger.8 Depression wiederum erhöht das Risiko für erneute kardiovaskuläre Ereignisse und erschwert oft die Adhärenz zur medikamentösen wie auch zur lebensstilbezogenen Therapie. Umso wichtiger ist ein niedrigschwelliges Screening auf psychische Erkrankungen, nicht nur in der Rehabilitation, sondern bereits in der stationären und ambulanten Akutversorgung. Als einfaches und valides Instrument stehen dafür Gesundheitsfragebögen wie der PHQ-4 zur Verfügung.9 Noch einfacher ist reflektierte Kommunikation auf Augenhöhe. Sie schafft hier die Grundlage für das Erkennen und Ansprechen psychischer Belastung.
Gute Kommunikation ist keine Zugabe, sondern Teil der Behandlung. Gerade bei ängstlichen Herzpatient:innen wirkt sie wie ein diagnostisches und therapeutisches Werkzeug: Sie erleichtert die Einschätzung der Beschwerden, reduziert Stress, fördert die Adhärenz und verbessert letztlich die ärztliche Beziehung. In einer zunehmend komplexen Medizin bleibt das Gespräch das einfachste, aber vielleicht wirksamste Mittel, wenn es bewusst und reflektiert geführt wird.