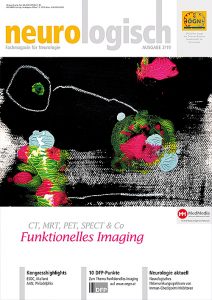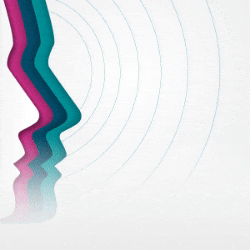Vorwort: Schwerpunkthema: Funktionelles Imaging
Liebe Leserinnen und Leser!
In den 1970er-Jahren hat sich die Computertomografie (CT) erstmals als strukturelle Imaging-Methode in der klinischen Routine etabliert, die dann in den 1990er-Jahren durch die Magnetresonanztomografie-(MRT-)Technik weiterentwickelt wurde. Moderne MRT-basierte Methoden haben in vielen Fragestellungen eine höhere Sensitivität und Spezifität. Damit konnte ein enormer Fortschritt in der In-vivo-Diagnostik erreicht werden. Unabhängig davon blieben jedoch viele funktionelle Störungen, die keiner strukturellen Läsion zugrunde liegen, bildgebend nicht nachweisbar. Dies änderte sich jedoch mit der Entwicklung nuklearmedizinischer Schichtbildverfahren, wie die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) und Single-Photonen-Emissions-Computertomografie (SPECT). Waren diese anfänglich nur seltene und teure Randmethoden, entwickelten sie sich aus der primären Forschungsanwendung rasch auch in den klinischen Workflow. Dies auch deswegen, da man bald den Mehrwert durch die Fusion von struktureller und funktioneller Bildgebung erkannte. Nicht zu vergessen ist, dass sich auch funktionelle Methoden – vor allem mit der Kernspintomografie, wie z. B. die funktionelle Kernspintomografie (fMRT) – entwickelt haben. Diese führten nicht nur in der Forschung zu neuen Erkenntnissen, sondern leisten heutzutage auch in der klinischen Routine bereits ihren Beitrag.
Im ersten Teil von Priv.-Doz. Dr. Markus Hutterer wird am Beispiel der Aminosäure-PET bei Gliomen erläutert, wie wichtig diese Untersuchungsmethoden in der Neuroonkologie geworden sind. Dabei spielt nicht nur die Einschätzung der Dignität, der Prognose und der genauen Ausdehnung von Tumoren eine wichtige präoperative Rolle (Biopsie und Resektionsplanung), sondern vor allem auch in der Nachsorge im Sinne des Therapiemonitorings und der Rezidiv-Diagnostik.
Im zweiten Teil beschäftigten sich Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Tatjana Traub-Weidinger und Dipl.-Phys. Dr. Tim Wollenweber mit einem zunehmend wichtigen Bereich, der Diagnose neurodegenerativer Demenzen. Mit der Entwicklung neuer Radiopharmaka wird die Differenzialdiagnose und vor allem die Frühdiagnostik von neurokognitiven Erkrankungen und Demenzen immer besser. Eine Mustererkennung im Glukosestoffwechsel-PET (FDG-PET) und im Perfusions-SPECT spielt in der Differenzialdiagnose der Demenzen eine wichtige Rolle. Weiters wurde die Diagnose einer Alzheimer-Erkrankung vor allem im Frühstadium durch die Amyloid-PET wesentlich spezifischer möglich. Was die Entwicklung neuer Tau-Tracer bringen wird, ist abzuwarten.
Auch der dritte Teil von Univ.-Prof. Dr. Walter Pirker beschäftigt sich mit Neurodegeneration, hier spezifisch im Bereich des dopaminergen Systems. Dienen hier CT und MRT in der Regel lediglich zum Nachweis struktureller Veränderungen, so lassen sich mit der SPECT- und der PET-Methode sehr wohl differenzialdiagnostische Einblicke in dieses Neurotransmittersystem sowie eine relativ sichere Differenzialdiagnose der Tremor- und Parkinson-Syndrome bzw. der milden Bewegungsstörungen bei anderen Erkrankungen oder ansonst gesunden älteren Personen machen.
Im letzten Teil beschäftigen sich Dr. Giorgi Kuchukhidze und Univ.-Prof. Dr. Ekaterina Pataraia mit funktioneller Bildgebung in der Epilepsie. Dabei kann die FDG-PET Aussagen über fokale funktionelle Störungen, z. B. bei der Temporallappenepilepsie, im Sinne einer präoperativen Fokussuche liefern. Mit der Perfusions-SPECT, wenn diese im Nahbereich einer Epilepsiemonitoringeinheit verfügbar ist, lassen sich aufgrund der raschen Tracer-Kinetik auch iktale Funktionszustände abbilden, die zur weiteren präoperativen Eingrenzung des Anfallsursprunges dienen. Die Befunde der molekularen Bildgebung können hier ebenso wie das fMRT entscheidend zum postoperativen Erfolg beitragen (auch was postoperative Defizite betrifft).
Zusammenfassend erweitert damit die funktionelle Bildgebung vor allem in der Kombination mit der Strukturbildgebung gerade in der Neurologie die diagnostischen Möglichkeiten in einem hohen Ausmaß mit entsprechenden Konsequenzen für die Therapie unserer PatientInnen.
Ich danke allen AutorInnen für ihre Mitarbeit zur Gestaltung dieses Schwerpunktes und wünsche eine interessante Lektüre!